Remove ads
Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) war eine sozialistische Partei im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Von Sozialdemokraten in der zweiten Hälfte des Ersten Weltkrieges gegründet, war sie eine Abspaltung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) (darauf informell MSPD). Die USPD bestand nach Parteieintritten von SPD-Mitgliedern, Gründungen von parteiinternen Organisationen und deren Abspaltung sowie zahlreichen Aus- bzw. Übertritten in andere Parteien bis zum Jahr 1931.

Die Partei ging aus der im Jahre 1916 von der SPD-Reichstagsfraktion (der 13. Wahlperiode) abgespaltenen Fraktionsgemeinschaft Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (SAG) hervor. Die Auseinandersetzungen innerhalb der SPD, einschließlich ihrer Fraktion, begannen mit unterschiedlichen Standpunkten in der Frage für oder gegen den Krieg (siehe auch → Burgfriedenspolitik). In diesem Zusammenhang stimmten während des Ersten Weltkrieges Hugo Haase, Karl Liebknecht und andere Angehörige der SPD-Fraktion gegen Kriegskredite im Parlament des Deutschen Reiches bzw. nahmen an den Abstimmungen nicht teil. Zu den Abstimmungsgegnern gehörten nicht nur Parteilinke, sondern auch Vertreter anderer SPD-Parteiströmungen. Ihnen allen gegenüber eskalierte die Disziplinierungspolitik der Mehrheit der Fraktion, ihrer Führung und anderer Teile der Partei. Die Kritik innerhalb der SPD gegen den Kreis um Haase nahm auch antisemitische Formen an.[1]
Höhepunkte nach der Parteigründung im Monat April 1917 waren ihre bedeutende Rolle bei den Massenstreiks im April 1917 sowie im Januar 1918, danach ihr Wirken in der Novemberrevolution 1918 und die Regierungsbeteiligungen der USPD im Rat der Volksbeauftragten und in den Ländern des Deutschen Reiches. Beispielsweise im Freistaat Bayern bzw. Freistaat Sachsen stellten sie mit Kurt Eisner und Richard Lipinski die Ministerpräsidenten. Wie auch andere sozialistische Parteien in internationalen Vereinigungen zusammenarbeiteten, tat dies die USPD ab 1921 in der Wiener Internationale. Im Gründungsjahr 1917 gehörten der USPD etwa 100.000 Menschen an, den Höhepunkt erreichte die Mitgliederzahl 1920 mit fast 900.000 (siehe unten → Tabelle Mitgliederzahlen).
Die USPD kam bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 nur auf 7,6 % der abgegebenen Stimmen, steigerte sich jedoch bei der ersten Reichstagswahl im Juni 1920 auf 17,6 Prozent. Die Abspaltung von Mitgliedern der/des Spartakusgruppe bzw. -bundes, die im Januar 1919 die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet hatten, wirkte sich noch nicht auf die Resonanz bei den Wählern aus. Mit dem Ergebnis von 1920 erreichte die Partei das beste deutschlandweite Resultat, aber bereits wenige Monate später verlor die USPD zahlreiche ihrer Machtpositionen. Während auf dem Leipziger Parteitag 1919 noch die Einheit der Partei bewahrt bleiben konnte, setzte zwischen 1920 und 1922 ihr Zerfall ein. Nach einem Beschluss des hallensischen USPD-Parteitages im Oktober 1920 gingen viele Mitglieder in die SPD zurück, weitere gründeten die USPD (Linke), die sich mit der KPD zur VKPD zusammenschloss. 1924 verließ die innerparteiliche Gruppe Sozialistischer Bund um Georg Ledebour, ein Mitglied der früheren SAG-Reichstagsfraktionsgemeinschaft, die Partei, die im Mai 1924 nicht mehr in den Reichstag gewählt wurde. 1931 traten die verbliebenen Mitglieder um Theodor Liebknecht, den letzten USPD-Vorsitzenden, einer neuerlichen Abspaltung der SPD – der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) – bei, was das Ende der Partei bedeutete.
Remove ads
Hugo Haase und Karl Liebknecht
Die beiden Abgeordneten der SPD-Fraktion im Reichstag von 1912 Hugo Haase und Karl Liebknecht waren bereits vor dem Ersten Weltkrieg als Kriegsgegner in Erscheinung getreten. Ende des 19. Jahrhunderts äußerten Abgesandte verschiedener Länder auf Zusammenkünften der Zweiten Internationale, ein Krieg soll in den betroffenen Ländern mit Generalstreik und anderen politischen Aktionen bis hin zu Aufständen bekämpft werden. Hugo Haase war ein Abgesandter Deutschlands und unterstützte die Forderung.
Karl Liebknecht veröffentlichte im Jahr 1907 Militarismus und Antimilitarismus, woraufhin er des Hochverrats angeklagt und zu Festungshaft für die Dauer von eineinhalb Jahren verurteilt wurde.
Erster Weltkrieg
Kriegskredite
In der Fraktionssitzung der SPD unmittelbar nach Kriegsausbruch zur Frage der Bewilligung der Kriegskredite sprach sich eine Minderheit von 14 Abgeordneten, darunter Karl Liebknecht und Hugo Haase, für eine Ablehnung aus. Bei der Abstimmung im Reichstag am 4. August 1914 beugten sie sich jedoch der Fraktionsdisziplin und sämtliche Abgeordnete der SPD stimmten, wie alle anderen auch, dafür. Im Dezember 1914, bei der zweiten Abstimmung im Reichstag, stimmte Karl Liebknecht als einziger Reichstagsabgeordneter gegen die erneute Bewilligung.[2]
Die Reaktionen der Parteibasis waren 1914 unterschiedlich. Bekannt ist, dass Karl Liebknecht auf Parteiversammlungen in Stuttgart (21. September) und Potsdam (4. November) einerseits sehr heftig für sein Abstimmungsverhalten am 4. August kritisiert wurde.[3] In der SPD-Wahlkreisorganisation Niederbarnim bestand dagegen eine starke Oppositionsströmung, die im Herbst 1914 Vervielfältigung und Versand der ersten Materialien der Gruppe um Liebknecht und Luxemburg (vgl. Spartakusbund) unterstützte.[4] Die SPD-Zeitung im Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha (vgl. Gothaer Volksblatt) verfolgte seit Kriegsausbruch einen kompromisslosen Oppositionskurs und musste im Februar 1915 – mehrfach verboten – ihr Erscheinen einstellen. Sie hatte unter der Leitung von Otto Geithner und Wilhelm Bock den Vorstand zuvor offen angegriffen und den von dort kommenden Vorwurf des Disziplinbruchs umgekehrt:
- „Wer übrigens wissen will, wo die Partei-Disziplinbrecher und ihre Verherrlicher sitzen, dem empfehlen wir das Studium der revisionistischen Bewegung der letzten 15 Jahre und im besonderen das der Verhandlungen des Magdeburger Parteitages von 1910.“[5]
In Württemberg führte das Vorgehen des Landesvorstands gegen die von linken Redakteuren geleitete Schwäbische Tagwacht schon im November 1914 zur faktischen Spaltung zunächst der Stuttgarter, im Juli 1915 schließlich auch der Landesparteiorganisation. Einzelne Gewerkschaftsfunktionäre traten ebenfalls von Anfang an gegen den neuen Kurs auf, vor allem in Berlin.[6]
Zudem verließen 1914 viele nicht-prominente Mitglieder aus einer oppositionellen Haltung heraus die SPD, darunter Karl Plättner, Hermann Matern und Adolf Benscheid. Den Austritt aus der „sozialimperialistischen“ SPD und den sofortigen Aufbau einer neuen Partei propagierte vor allem Julian Borchardt in seiner Zeitschrift Lichtstrahlen.
Im Januar 1915 forderte Carl Legien die Partei- und Gewerkschaftsleitungen erstmals auf, aktiv gegen die „Anarchisten“ an der Basis vorzugehen.[7] Die oppositionellen Aktivitäten in diesem Bereich führten bei Exponenten des rechten Parteiflügels wie Eduard David wiederholt zu regelrechten „Hassausbrüchen“.[8]
Bei der nächsten Abstimmung für weitere Kriegskredite im März 1915 kam zu Liebknechts Gegenstimme eine weitere eines SPD-Abgeordneten, die Otto Rühles, hinzu.
Das Gebot der Stunde und Zurückeroberung der Partei
Anders als Borchardts Reaktion mit seinem Parteiaustritt orientierte sich die Gruppe um Liebknecht und Luxemburg bis zum Herbst 1916 auf eine „Zurückeroberung der Partei“. In diesem Sinne argumentierte auch ein am 9. Juni 1915 als Flugblatt veröffentlichter Aufruf Liebknechts, der von über 1.000 Parteifunktionären und -mitgliedern unterzeichnet worden war.
Zehn Tage später veröffentlichten Karl Kautsky, Hugo Haase und Eduard Bernstein, die den Liebknechtschen Aufruf nicht unterstützt hatten, in der Leipziger Volkszeitung unter dem Titel Das Gebot der Stunde eine Erklärung, mit der sie sich an die Spitze der Oppositionsbewegung zu setzen versuchten. Der Text sprach sich lediglich in allgemeinen Worten gegen den Krieg und für einen Verhandlungsfrieden aus, erregte aber wegen der Prominenz der Unterzeichner erhebliches Aufsehen und wurde nach Liebknechts „Nein“ im Reichstag als zweiter großer Schlag gegen die Burgfriedenspolitik des Parteivorstands wahrgenommen.[9]
Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft
Nachdem im Dezember 1915 inzwischen 18 – meist aus der zentristischen Strömung der Vorkriegs-SPD kommende – Abgeordnete mit Liebknecht und Rühle gegen weitere Kriegskredite votiert hatten, gingen Fraktions- und Parteivorstand verstärkt mit administrativen Mitteln gegen die Opposition vor: Liebknecht wurde am 12. Januar 1916 aus der Fraktion ausgeschlossen, Rühle trat zwei Tage später aus Solidarität mit Liebknecht aus, die 18 anderen Abweichler wurden am 24. März ausgestoßen und bildeten daraufhin die Fraktionsgemeinschaft Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (SAG), betrachteten sich aber weiterhin als Mitglieder der SPD. Liebknecht – dem einige Monate später nach seiner Verurteilung wegen „Kriegsverrats“ das Mandat aberkannt wurde – und Rühle lehnten den angebotenen Anschluss an die SAG ab.
Die konfrontierenden Äußerungen des Reichstagsabgeordneten Eduard David gegen die Opposition in der Fraktion enthielten nun auch antijüdische Passagen, ebenso tönten die Abgeordneten Gustav Bauer und Carl Legien, mit der Judenbande (müsse) Schicht gemacht werden.[10]
SPD-Parteikonferenz
Im Juli 1916 beschloss die Mehrheit des damaligen SPD-Vorstands baldmöglichst eine Parteikonferenz zu veranstalten. Eugen Prager schrieb 1921, dass der Vorstand die innerparteiliche Verankerung der Opposition in „kaum glaublicher Kurzsichtigkeit“ massiv unterschätzte.[11] Ursprünglich bestand die Absicht, einen Parteitag einzuberufen, was aber von der Opposition, die praktisch keine Möglichkeit mehr hatte, legal und öffentlich für ihre Positionen zu werben, vehement abgelehnt wurde; die Parteilinke willigte auch nur widerwillig in die Parteikonferenz ein, da sie davon ausging, dass die Parteiinstanzen trotz gegenteiliger Versicherungen versuchen würden, sich auf dieser Konferenz den 1914 eingeschlagenen Kurs bestätigen zu lassen. Da eine Parteikonferenz im Statut nicht vorgesehen war, konnte die Parteiführung den Delegiertenschlüssel regulärer Parteitage durch einen neuen, für die bekannten Hochburgen der Opposition höchst nachteiligen ersetzen und die Zusammensetzung der Konferenz so „manipulativ beeinflussen“.[12] Um dennoch nichts dem Zufall zu überlassen, erhielten auch die 77 Mitglieder der Reichstagsfraktion und die Angehörigen des Parteivorstands, des Parteiausschusses und der Kontrollkommission volle Delegiertenrechte. Trotz der strukturellen Benachteiligung bei der Delegiertenauswahl stellte die Opposition überraschend etwa die Hälfte der 307 gewählten Delegierten, als die Konferenz am 21. September 1916 in Berlin zusammentrat. Damit war offensichtlich geworden, dass der Parteivorstand nicht mehr die Mehrheit der Parteimitglieder vertrat. Sofort bei Eröffnung der Veranstaltung wurde auch deutlich, dass sich die beiden Flügel „voll auf Kollisionskurs“[13] befanden: In einer erbittert geführten Geschäftsordnungsdebatte stritt man darüber, ob Hugo Haase, der am 25. März das Amt des Parteivorsitzenden niedergelegt hatte, das gleiche Rederecht wie Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann zustehe. Vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Konferenzteilnehmern. Ebert und Scheidemann versuchten in ihren Reden erneut, die Kreditbewilligung durch den Hinweis auf den vermeintlich „aufgezwungenen Verteidigungskrieg“ gegen das „reaktionäre Zarenreich“ zu rechtfertigen. Dass die Reichsregierung expansive Absichten verfolge, bestritten sie (wider besseres Wissen).[14] Ebert räumte ein, dass die Mitgliederzahl der Partei seit Kriegsbeginn um 64 % zurückgegangen sei, führte dies aber ausschließlich auf Einberufungen zum Militärdienst und die Härten der Kriegszeit zurück. Die Redner der Opposition betonten, dass die Reichsleitung jederzeit Frieden schließen könne, wenn sie auf Annexionen und Kontributionen verzichte. Haase beschwor wie Ebert die Einheit der Partei, „aber nicht eine[r] Partei, in der dem Imperialismus offen oder versteckt Zugeständnisse gemacht werden.“[15] Durch die Delegierten der Reichstagsfraktion und des Parteiapparats verfügte der Parteivorstand über eine komfortable Mehrheit (276 gegen 169 Stimmen) und versuchte deshalb, wie von der Opposition erwartet auch, das erhoffte Plazet für seine Politik zu erhalten. Die oppositionellen Delegierten lehnten eine Entscheidung unter diesen verzerrten Bedingungen allerdings ab und nahmen an den einschlägigen Abstimmungen nicht teil. So verabschiedete die rechte Mehrheit am Ende der Konferenz „einmütig“ mehrere Resolutionen, die die Vorstandspolitik bestätigten.[16] Auf der Reichskonferenz konnten Paul Frassek, Friedrich Schnellbacher und Käte Duncker die Positionen der Spartakusgruppe, die ursprünglich für den Boykott der Konferenz geworben hatte, erstmals vor einer größeren Parteiöffentlichkeit vertreten. Duncker griff in ihrer Rede den rechten Flügel an, distanzierte sich aber auch von der Linie der SAG und legte so den konzeptionellen Riss innerhalb der linken Opposition, der bald darauf auch die USPD durchzog, offen:
- „Die Arbeitsgemeinschaft und ihre Anhängerschaft, soweit wenigstens sich ihre Stellungnahme nicht in der Ablehnung der Kriegskredite erschöpft, trachtet danach, die Partei etwa wieder auf den Standpunkt zurückzubringen, den sie vor dem 4. August einnahm, den Stand der Internationale so wieder herzustellen, unsere sogenannte ’altbewährte’ und ’sieggekrönte’ Taktik vor dem Kriege wieder aufzunehmen. Obwohl gerade der 4. August doch wohl am deutlichsten bewiesen hat, dass diese Taktik sich nicht bewährt hat, dass sie uns nicht zum Sieg, sondern geradezu zu einer vernichtenden Niederlage geführt hat, gerade da, wo sie hätte ihre Probe ablegen müssen.“[15]
Die SPD-Instanzen gingen nach der Reichskonferenz weiter und eher noch verstärkt gegen regionale und publizistische Positionen der Linken vor. Dabei wurde die Spaltung der Partei zumindest in Kauf genommen, von nicht wenigen Wortführern des äußersten rechten Flügels, aber auch bewusst „ersehnt“.[17] Höhepunkt dieser zum Teil im Zusammenspiel mit Zensurbehörden und Gerichten vorangetriebenen Maßnahmen war der sogenannte Vorwärts-Raub im Oktober 1916, durch den das bis dahin von zentristischen Redakteuren geprägte Blatt unter die Kontrolle des Parteivorstands geriet. Am 10. November gründeten Eugen Ernst und Otto Wels den Verein Vorwärts – Lese- und Diskutierclub für Groß-Berlin, der sich um die fraktionelle Zusammenfassung der spätestens seit der Vorwärts-Krise völlig an den Rand gedrängten Vorstandsanhänger im Parteibezirk Groß-Berlin bemühte.[18]
Beitragssperren, Parteiausschlüsse und -austritte
Anfang Dezember 1916 sorgte der summarische Ausschluss des sozialdemokratischen Wahlvereins Bremen, der dem Vorstand die Beiträge gesperrt hatte, für Aufsehen.[19] Auch hier hatte die rechte Minderheit zuvor eine Parallelstruktur geschaffen.
Vor diesem Hintergrund rief der Vorstand der SAG für den 7. Januar 1917 die erste Reichskonferenz der sozialdemokratischen Opposition in Berlin zusammen. An ihr nahmen 138 Delegierte und 19 Reichstagsabgeordnete teil. Vor allem der Kreis um Karl Kautsky hatte der SAG-Führung zu diesem Schritt geraten und dabei die Absicht verfolgt, dem Einflussgewinn der radikalen Linken um Liebknecht und Rosa Luxemburg durch die Organisation einer „verantwortlichen Opposition“ zu begegnen: Für Kautsky bestand die Frage nicht mehr darin, „ob die Opposition siegt, sondern welche Art der Opposition siegen wird. […] Die Gefahr, die von der Spartacusgruppe ausgeht, ist eine große. […] Liebknecht ist heute der populärste Mann in den Schützengräben, das wird von allen übereinstimmend versichert, die von dort kommen.“[20] Obwohl die Reichskonferenz die Initiativen der Spartakusgruppe – Beitragssperre, Aufruf zum offenen Kampf gegen den Parteivorstand unter Inkaufnahme der Spaltung der Partei, Orientierung auf eine revolutionäre Beendigung des Krieges – mehrheitlich zurückwies und sich sogar zur „Landesverteidigung“ bekannte, hielt der SPD-Vorstand an seinem Konfrontationskurs fest: Er schloss am 18. Januar die SAG-Abgeordneten und die führenden Köpfe der Spartakusgruppe aus der SPD aus und forderte die lokalen Parteigliederungen auf, mit deren Anhängern vor Ort ebenso zu verfahren. Obwohl die SAG-Führung es danach noch immer vermied, die Bildung einer neuen Partei zu propagieren, traten nun – zur Überraschung der SAG wie der SPD-Führung – ganze Ortsvereine aus der SPD aus. Daraufhin rief am 9. Februar 1917 auch die SAG, deren Leitung – allen voran Hugo Haase – sich bis zuletzt gegen diesen Schritt gesperrt hatte, zur organisatorischen Sammlung der Opposition auf.[21] Als Beweggründe hierfür benannte sie in dem Aufruf die „planmäßige Schaffung von Sonderorganisationen durch den Parteivorstand“ und den Umstand, dass „ein Dutzend zur Besorgung zentraler Parteigeschäfte angestellter Parteibeamten wider alles Parteirecht sich anmaßen, nach eigenem Gutdünken den Ausschluss einzelner Parteigenossen und ganzer Organisationen aus der Partei zu dekretieren.“[22]
Remove ads
Gründung der USPD

Die SAG richtete vom 6. bis 8. April 1917 in Gotha, der Stadt des historischen Vereinigungskongresses von 1875, im Volkshaus zum Mohren eine zweite Reichskonferenz der Opposition aus. Hier konstituierte sich die USPD als eigenständige Partei. Einige Delegierte schlugen als alternativen Parteinamen die Bezeichnung Kommunistische Arbeiterpartei vor. Der endgültige Entschluss zur Gründung einer neuen Partei wurde wahrscheinlich erst in Gotha gefasst. Nicht genau geklärt ist, von wem der letzte Anstoß hierzu ausging. Zumindest ein Teil der Delegierten scheint in der Erwartung nach Gotha gereist zu sein, dass dort lediglich eine festere Verbindung der sozialdemokratischen Opposition inner- und außerhalb der SPD angestrebt werde. Kautsky hat – allerdings im Kontext seiner Rückkehr zur SPD fünf Jahre später – zu suggerieren versucht, dass die Gründung der USPD auf eine Art Überrumpelung durch die „Spartakisten“ zurückzuführen sei:
- „Da tauchte plötzlich in Gotha der Vorschlag auf, wir sollten uns konstituieren als Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Vergebens sprachen Eisner, Bernstein und ich gegen diesen Vorschlag, der die offene Spaltung mit ihren verhängnisvollen Konsequenzen bedeutete. Gegen uns sprachen Ledebour, Herzfeld, Heckert, und sie gewannen die Mehrheit, 77 gegen 42 Stimmen. [Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der Abstimmung über den Entwurf des Organisationsstatuts, mit dem unter anderem der neue Parteiname festgelegt wurde. Ein Großteil der Gegenstimmen kam von Delegierten, die eine andere Namensgebung favorisierten, aber nicht gegen die Parteigründung als solche opponierten.] Wären die Anhänger der Arbeitsgemeinschaft unter sich geblieben, ohne Zuziehung der Spartakisten, das Ergebnis wäre wohl ein anderes gewesen.“[23]
Der kriegsbejahende Flügel der SPD firmierte fortan als Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands (MSPD) mit Friedrich Ebert als Parteivorsitzendem.

An der Gothaer Gründungsversammlung im Volkshaus zum Mohren nahmen 124 Delegierte aus 91 sozialdemokratischen Wahlkreisorganisationen und 15 Reichstagsabgeordnete teil. Zu Vorsitzenden wurden Hugo Haase und Georg Ledebour gewählt, Wilhelm Dittmann wurde geschäftsführender Sekretär. In das Zentralkomitee der Partei wählten die Delegierten Hugo Haase, Luise Zietz, Adolf Hofer, Robert Wengels, Wilhelm Dittmann, Georg Ledebour und Gustav Laukant. Die USPD war insgesamt äußerst heterogen zusammengesetzt und speiste sich aus einander zum Teil offen bekämpfenden Strömungen: In ihr sammelten sich sozialdemokratische Traditionalisten wie Haase, revisionistische Kriegsgegner wie Kurt Eisner und Eduard Bernstein, führende Theoretiker des einstigen „marxistischen Zentrums“ wie Karl Kautsky und die marxistischen Revolutionäre der Spartakusgruppe. In Berlin entstand mit den revolutionären Obleuten eine konfliktfreudige gewerkschaftliche Basisbewegung, die eng mit der dortigen USPD-Organisation verbunden war. Nur die linksradikalen Gruppen in Norddeutschland (vgl. Bremer Linksradikale) lehnten es prinzipiell ab, sich der neuen Partei anzuschließen (und kritisierten die Spartakusgruppe heftig für deren Haltung gegenüber der USPD).
Die kleine, aber sehr aktive, bereits seit 1915 bestehende Gruppe Internationale – seit 1916 in der Öffentlichkeit zumeist als „Spartakusgruppe“ besprochen – um Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Julian Marchlewski, Franz Mehring, Wilhelm Pieck, August Thalheimer und Clara Zetkin, die die Burgfriedenspolitik der SPD von Beginn an entschieden abgelehnt hatte und an den Parteibeschlüssen aus der Vorkriegszeit festhielt, spielte in vielerlei Hinsicht eine besondere Rolle. Die Gruppe gab mit den Spartakusbriefen ein eigenes illegales Periodikum sowie kontinuierlich Flugschriften und Flugblätter heraus. Sie trat der USPD geschlossen und unter dem Vorbehalt völliger politischer Selbständigkeit bei. Die Spartakusgruppe bestand 1917 aus etwa 2.000 Aktivisten, war aber weitaus einflussreicher, als es die relativ geringe Mitgliederzahl vermuten lässt.[24] Ihr Verhältnis zur USPD war widersprüchlich:[25] Zwar entschied sie sich – auch gegen Widerstände in den eigenen Reihen – für den Anschluss an die Partei, nahm aber in ihrer Agitation keinerlei Rücksicht auf deren offizielle Linie und unterzog dieselbe stattdessen einer permanenten Kritik.[26] Der bewusste Verzicht auf die zweifellos mögliche Gründung einer selbstständigen linksradikalen Partei im Frühjahr 1917 war die einzige grundlegende Entscheidung der Spartakus-Führung, die später von Autoren der KPD bzw. der einschlägigen Geschichtsschreibung in der DDR offen und heftig kritisiert wurde. Wilhelm Pieck, der den Kurs 1917 mitgetragen hatte, sprach 1943 von einem „schweren Unterlassungsfehler“,[27] der die revolutionäre Strömung der deutschen Arbeiterbewegung weiterhin einer reformistischen Führung – eben der USPD – ausgeliefert und sich vor allem im Zuge der Novemberrevolution bitter gerächt habe.
Die engere Führung der USPD bestand indes trotz des disparaten Sammlungscharakters der Partei anfänglich fast ausschließlich aus Angehörigen der traditionalistisch-zentristischen Strömung.[28] Sie verstand die USPD in erster Linie als Neugründung der „alten SPD“ und verkündete demgemäß in ihrem Aufruf vom 13. April 1917, dass „in Gotha die alte Sozialdemokratie neu entstanden ist“.[29] Ganz in diesem Sinne bezeichneten sich etwa die zur USPD übergetretenen preußischen Landtagsabgeordneten als Sozialdemokratische Fraktion (Alte Richtung).[30] Durch die weitgehende Übernahme des Chemnitzer Parteistatuts von 1912 in die Grundlinien der USPD wurde dieser Anspruch noch unterstrichen. Rosa Luxemburg kritisierte dies als „tragikomisches Schlagen nach dem eigenen Schatten“ und warf der Parteiführung vor, „geflissentlich [zu vermeiden], die politischen Wurzeln des Bürokratismus und der ganzen Entartung der Demokratie in der alten Partei“[31] zu thematisieren.
Wenige Monate nach der Gründung hatte die USPD etwa 120.000 Mitglieder (SPD im März 1917: 243.000).[28] Die SPD-Bezirke Groß-Berlin, Halle/Saale, Erfurt, Leipzig, Braunschweig und Frankfurt am Main (mit zusammen 36 Wahlkreisorganisationen) waren fast geschlossen zur USPD übergetreten, ebenso einzelne wichtige Wahlkreisorganisationen wie Königsberg-Stadt, Solingen, Essen, Düsseldorf, Gotha und Bremen.[32] In Leipzig und Umland, dem alten Kerngebiet der Sozialdemokratie, „brach die alte SPD regelrecht zusammen“[33]: hier hatte sie unmittelbar nach der Spaltung weniger als 100, die USPD dagegen über 30.000 Mitglieder, in Groß-Berlin standen 28.000 USPD-Mitgliedern noch 6.475 SPD-Mitglieder gegenüber.[34] Otto Wels beklagte am 30. Mai 1917 im Kreise von SPD-Funktionären, dass alles, „was an energischen Leuten noch vorhanden ist“,[35] zu den Unabhängigen hinneige. Die USPD litt in den ersten Monaten ihres Bestehens nichtsdestotrotz stark unter einer ihr gegenüber besonders repressiven Handhabung des Belagerungszustandes durch die Militärbehörden, die ausdrücklich angewiesen worden waren, der Partei die „Möglichkeit zur Verbreitung ihrer Gesinnung im Volke“[36] zu nehmen. Zensur, Redeverbote für die Parteiführer, Versammlungs- und Zeitungsverbote sowie gezielte Einberufungen führender Funktionäre versetzten die Partei vielerorts „in eine Art Halblegalität“.[37]
Die Politik der USPD bis zum Ende des Weltkrieges

Unter dem Eindruck der russischen Februarrevolution und der fast gleichzeitigen Konstituierung der USPD sah sich die SPD-Führung zu einigen Kurskorrekturen gezwungen, die nicht ohne Folgen für die politischen Aussichten der USPD blieben. Die Formel des Petrograder Sowjets „Friede ohne Annexionen und Kontributionen“ hatte in allen Strömungen der deutschen Arbeiterbewegung breite Zustimmung gefunden. Am 19. April 1917 stellte sich der SPD-Parteiausschuss in einem Beschluss hinter diese Orientierung, Ende Juni drängte er die Parteiführung sogar, die neue Kriegskreditvorlage abzulehnen, falls die Reichsregierung sich nicht eindeutig zu den Kriegszielen erkläre und zusichere, dass es nach dem Kriege zu einer inneren Neuordnung kommen werde. Dieser Schwenk limitierte den Zustrom zur USPD, die nicht zum letzten Mal zunächst sprachlos auf eine grundlegende Kehrtwende der SPD reagierte:
- „Ihre klägliche Haltung suchte die Mehrheitspartei durch eine lärmvolle Polemik mit den Alldeutschen zu vertuschen und zu verdecken. […] Wer die Haltung der Mehrheitssozialisten seit Kriegsbeginn miterlebt, wie wir von der Opposition, kam jetzt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die ‚Regierungssozialisten‘ gebärdeten sich in der Polemik mit den Alldeutschen, als wenn sie seit Kriegsbeginn ununterbrochen einen energischen Kampf gegen die Annexionspolitiker geführt und von der Regierung ein unzweideutiges Bekenntnis zu einem Frieden ohne Annexionen und Kriegsentschädigungen gefordert hätten. […] Der eifrigste Agitator für den ‚Frieden ohne Annexionen und Kontributionen‘ war im regierungssozialistischen Lager jetzt – Philipp Scheidemann, derselbe Scheidemann, der vorher am meisten dahin gewirkt hatte, eine solche Agitation zu verhindern.“[38]
Der neuen Linie der SPD schlossen sich Zentrum und Fortschrittliche Volkspartei an; gemeinsam brachten die drei Parteien am 19. Juli 1917 die sogenannte Friedensresolution durch den Reichstag. Die USPD-Fraktion wies auf die Zweideutigkeiten dieses Textes hin, charakterisierte ihn als leicht durchschaubare innen- und außenpolitische Taktiererei und lehnte ihn folgerichtig ab. Eine von ihr eingebrachte Konkurrenzresolution, die sich völlig eindeutig gegen Annexionen, für die Aufhebung des Belagerungszustandes und die Demokratisierung des Reiches aussprach, wurde umgekehrt von allen anderen Parteien abgelehnt. Am folgenden Tag bewilligte der Reichstag gegen die Stimmen der USPD die neue Kriegskreditvorlage.
Knapp zwei Monate später nahm eine Delegation der Partei (Haase, Ledebour, Käte Duncker und Arthur Stadthagen) an der internationalen sozialistischen Konferenz in Stockholm (sog. dritte Zimmerwalder Konferenz, 5.–12. September) teil, deren Abschlussresolution sich für „Massenaktionen“ und einen „Massenstreik“ zur Beendigung des Krieges aussprach. Während Duncker und teilweise auch Ledebour bei zentralen Fragen – Verhältnis zu den rechten Sozialdemokraten, Art und Weise des Antikriegskampfes, Frage einer neuen Internationale – im Grundsatz die Auffassungen der Bolschewiki teilten, trat Haase zurückhaltender auf und verhinderte unter anderem die Annahme einer gegen die Menschewiki gerichteten Resolution.[39] Der in der Abschlussresolution gegebenen Orientierung folgten die prominenten Sprecher der USPD im Reichstag in den nächsten Monaten allerdings ohne erkennbare Vorbehalte.[40]
Schon zuvor – praktisch im Augenblick ihrer Gründung – war die USPD in „Massenkämpfe“ des in Stockholm geforderten Zuschnitts verwickelt worden. Mitte April 1917 brachen in mehreren rüstungsindustriellen Zentren – namentlich in Hochburgen der USPD wie Berlin, Leipzig, Braunschweig und Halle – Streiks aus, an denen sich hunderttausende Arbeiter beteiligten.[41] Letzter Auslöser für die Streikbewegung war die zum 1. April erfolgte Senkung der Brotrationen. Die Streikenden formulierten neben rein ökonomischen auch eine Vielzahl politischer Forderungen. In zwei Berliner Betrieben – bei Knorr-Bremse und DWM – wurden erstmals in Deutschland Arbeiterräte gebildet. Bis zum 24. April gelang es den Gewerkschaftsleitungen und den Militärbehörden allerdings, die Streiks abzuwürgen. Nach Angaben Friedrich Thimmes sahen die „Herren von der Sozialdemokratie“ – gemeint ist die Führung der SPD – die Streiks als „pure[n] Landesverrat“ an und erklärten ihm gegenüber, ihre Hauptaufgabe darin zu sehen, dieselben „einzudämmen und abzublasen.“[42] Dagegen stellte sich die USPD weitgehend geschlossen und uneingeschränkt hinter die Streikbewegung. Viele lokale USPD-Funktionäre hatten die Streiks mit vorbereitet (beim Gründungsparteitag in Gotha sollen sich nach Aussage eines Beteiligten einzelne Delegierte „abseits und ohne Mitwirkung der führenden Geister der Tagung“[43] hierzu verabredet haben) und führten sie aktiv durch, die Spartakusgruppe warb in Flugblättern für die Ausweitung und weitere Politisierung der Ausstände, in Berlin trat mit Haase, Ledebour, Arthur Stadthagen und Adolph Hoffmann die erste Reihe der Partei als Redner auf Streikversammlungen auf. Eine Delegation der Leipziger USPD (Richard Lipinski, Arthur Lieberasch, Hermann Liebmann) wurde von den dortigen Streikenden beauftragt, dem Reichskanzler einen umfangreichen Forderungskatalog vorzutragen;[44] im Falle einer ablehnenden Antwort sollte „überall sofort ein Arbeiterrat eingesetzt werden.“[45] Erst Jahre später wurde bekannt, dass sich Hugo Haase auf dem Höhepunkt der Streikbewegung vertraulich mit dem Chef des Kriegsamtes, General Wilhelm Groener, getroffen und diesem zugesichert hatte, seinen Einfluss dahingehend geltend zu machen, dass spätestens am 1. Mai nicht mehr gestreikt werde. Groener, der das Treffen 1925 als Zeuge im Münchner Dolchstoßprozess publik machte, will bei dieser Gelegenheit den sicheren Eindruck gewonnen haben, dass Haase „alles andere war, nur kein revolutionärer Führer.“[46] Zwar agierte Haase im April 1917 nicht – wie bald darauf die SPD-Führung während des Januarstreiks – mit dem direkten Vorsatz, die Streikbewegung als solche zu untergraben, sah aber hier und später eine erschütterungsfreie, demokratisch-„sozialpazifistische“ Evolution hin zum äußeren Frieden und schließlich zum Sozialismus als theoretisch möglich und praktisch wünschenswert an. Illegalen und nicht genau berechenbaren außerparlamentarischen „Aktionen“, die nicht nur die Spartakusgruppe seit der russischen Februarrevolution unaufhörlich forderte, standen Haase und der Rest der engeren USPD-Führung – abgesehen allein von Ledebour – deshalb passiv und insgeheim ablehnend gegenüber. Dennoch begünstigten die wiederholten, von der Tribüne des Reichstages und in der Parteipresse geäußerten allgemeinen Appelle an „die Massen“ aktivistische Vorstöße lokaler USPD-Gliederungen. So führte die Merseburger USPD am 15. August 1917 alle 12.000 Arbeiter der Leuna-Werke in einen 24-stündigen, mit einer Demonstration durch die Stadt abgeschlossenen Proteststreik, der auch auf einige Orte der näheren Umgebung übergriff.
Die Aprilstreiks drängten die USPD-Führung indirekt noch in eine weitere von ihr so nicht gewollte Auseinandersetzung. Trotz gegenteiliger Zusicherungen waren nach dem Ende der Ausstände zahlreiche Streikteilnehmer einberufen worden, viele davon zur Hochseeflotte. In ihren Stammakten wurden Sondervermerke angebracht; in Einzelfällen brachten die heimatlichen Militärbehörden zum Ausdruck, dass sie es begrüßen würden, wenn der Betreffende nicht mehr zurückkehrte.[47] Die Anwesenheit dieser hoch politisierten Neuankömmlinge trug erheblich zur Radikalisierung der Schiffsbesatzungen bei, die ohnehin zu großen Teilen aus der Facharbeiterschaft der Großstädte rekrutiert worden waren, mit der USPD sympathisierten (allein auf dem Linienschiff Friedrich der Große kursierten ständig dutzende Exemplare der Leipziger Volkszeitung) und schon länger über Schikanen durch Offiziere, schlechte Verpflegung und die von Teilen der Besatzungen zu leistende Zwangsarbeit in den Werften Klage führten. Seit Juni 1917 entstand, gestützt auf die von den Matrosen gegen den Widerstand der Offiziere gebildeten Menagekommissionen, eine illegale, etwa 5.000 Mann starke Organisation, deren Führer einen „Generalstreik“ in der Flotte vorbereiteten. Anfang August wurde diese Organisation durch Spitzel aufgedeckt, die aufgeschreckte Marinejustiz verhängte fünf Todesurteile (von denen zwei – gegen Albin Köbis und Max Reichpietsch – vollstreckt wurden) und über 50 Zuchthausstrafen. Die Ermittlungen ergaben, dass Köbis, Reichpietsch und Willy Sachse den direkten Kontakt zur Führung der USPD gesucht hatten und auch mehrmals mit Dittmann, Luise Zietz und Adolph Hoffmann zusammengetroffen waren.[48] Diese hatten ihnen allerdings von illegalen Aktionen und vor allem von der von den Matrosen vorgeschlagenen Mitgliederwerbung für die USPD abgeraten. Zumindest Reichpietsch – und damit der eigentliche Kopf der Organisation – begriff seine Tätigkeit aber als Parteiarbeit und sich selbst als Mitglied der USPD.[49] Wegen dieser als „Staatsgefährdung“ gewerteten Verbindungen griffen Reichskanzler Michaelis und Staatssekretär Capelle die USPD am 9. Oktober im Reichstag an und drohten indirekt mit einem Verbot der Partei.[50] Haase, Vogtherr und Dittmann kritisierten zwar die verhängten Todesurteile scharf, bemühten sich bei dieser Gelegenheit allerdings auch erfolgreich um den Nachweis, dass die Parteiführung die Grenze der Legalität zu keinem Zeitpunkt überschritten habe. Damit desavouierten sie in gewisser Weise jene Militärangehörigen, die innerhalb ihrer Einheiten für die USPD warben, und vergaben die „große Chance, sich illegale Organisationen innerhalb der Armee zu schaffen.“[51]
Die russische Oktoberrevolution wurde von der großen Mehrheit der USPD uneingeschränkt begrüßt. Die Parteiführung übermittelte unmittelbar nach Bekanntwerden der Petrograder Ereignisse in einem Telegramm „dem russischen Proletariat zur Ergreifung der politischen Macht wärmste Glückwünsche“,[52] zahlreiche Lokalorganisationen äußerten sich im gleichen Sinne. Für den 18. November 1917 kündigte die Berliner USPD zehn (ohne Ausnahme verbotene) Großversammlungen zu diesem Thema an. Unter dem Eindruck der Oktoberrevolution begann allerdings auch – zunächst kaum beachtet – die letzte, erst 1921/1922 abgeschlossene Etappe der folgenreichen politisch-theoretischen Transformation des alten „marxistischen Zentrums“. Während dessen politische Praktiker in der Führung der USPD – mit Haase an ihrer Spitze – nicht nur nach außen hin, sondern auch „subjektiv ehrlich“[53] die Entwicklungen in Russland begrüßten, trat der engere Kreis um Kautsky, dem auch im deutschen Exil lebende Menschewiki angehörten, von der ersten Stunde an ablehnend gegenüber dieser Revolution auf. Die wenig überzeugenden Versuche, diese Ablehnung theoretisch zu begründen, trugen ganz erheblich dazu bei, dass der persönliche Einfluss Kautskys innerhalb der USPD zunehmend sank und 1919/1920 einen Tiefpunkt erreichte. Kernstück von Kautskys Argumentation war der „Nachweis“, dass eine sozialistische Revolution in Russland wegen dessen sozioökonomischer Rückständigkeit „unmöglich“ sei. Da er bei anderen Gelegenheiten versuchte, die ebenfalls von ihm behauptete „Unzeitgemäßheit“ einer sozialistischen Revolution in Westeuropa – hier verstanden als Gegensatz zur „unvermeidlichen“ Evolution – mit Verweis auf das dort gegebene hohe Niveau gesellschaftlicher Entwicklung zu begründen, wirkte dieser Standpunkt schon auf den ersten Blick paradox und wurde von seinen Kritikern auf die von Kautsky nicht mehr glaubwürdig zu dementierende Konsequenz „Verzicht auf die Revolution überall und unter allen Umständen!“[54] zugespitzt. Damit setzte sich Kautsky nicht nur und erneut in völligen Gegensatz zur Spartakusgruppe, sondern auch zum Selbstverständnis der übergroßen Mehrheit der Mitglieder und Funktionäre der USPD. Haase versuchte wiederholt (und vergeblich), Kautsky in persönlichen Briefen wegen der in den folgenden Monaten immer weiter eskalierenden antibolschewistischen Polemik in den von ihm beeinflussten Teilen der USPD-Presse zur Ordnung zu rufen:
- „Gerade jetzt, wo die Bolschewiki von allen kapitalistischen Regierungen umdrängt werden, halte ich es für einen schweren Fehler, gegen sie eine Polemik zu führen. […] Mehr als je vertrete ich die Meinung, dass die Sozialistische Auslands-Korrespondenz objektive Berichte über Russland zur Orientierung der Leser bringen soll […]. Dringend warnen möchte ich vor jeder Ausführung, die auch nur so ausgelegt werden könnte, als ob die konterrevolutionären Kräfte in Russland, als ob die kapitalistischen Kreise – wenn auch gegen die Absicht des Verfassers – gestützt werden. […] Wir würden dadurch Kämpfe in unserer Partei entfesseln, während wir den engsten Zusammenschluss gegen die Imperialisten aller Richtungen, auch der regierungssozialistischen, brauchen.“[55]
Das im Januar 1918 nach und nach bekanntwerdende aggressive Auftreten der deutschen Delegation bei den Brest-Litowsker Verhandlungen löste in der Arbeiterbewegung eine starke, zu Aktionen drängende Erbitterung aus. Ledebour, Adolph Hoffmann und Joseph Herzfeld setzten gegen den erheblichen Widerstand gemäßigter USPD-Führer durch, dass die Reichstagsfraktion ein schließlich massenhaft verbreitetes Flugblatt herausgab, das – ähnlich wie die Aufrufe der Spartakusgruppe Die Stunde der Entscheidung! und Hoch der Massenstreik! Auf zum Kampf! kurz zuvor – zu konkreten und unmittelbaren „Willenskundgebungen der werktätigen Bevölkerung“ aufforderte („Die Stunde ist gekommen, eure Stimme für einen solchen Frieden zu erheben! Ihr habt jetzt das Wort!“).[56] Am 28. Januar begann der bis dahin größte politische Streik in Deutschland, der, ausgehend von Berlin, auch auf andere Industriezentren übergriff. In München wurde am 31. Januar Kurt Eisner verhaftet, nachdem er vor Streikenden gesprochen hatte. In Berlin wurde der Streik von einem elfköpfigen Aktionsausschuss der Betriebsobleute (fast alle Mitglieder des Ausschusses gehörten der USPD an) geführt, die zunächst drei USPD-Vorständler kooptierten (Haase, Ledebour und Dittmann), schließlich aber auch – was zunächst klar abgelehnt worden war – die SPD aufforderten, drei Vertreter zu entsenden. Nach dem Eingreifen des Militärs und der Verhängung des verschärften Belagerungszustands beschloss der Aktionsausschuss auf Drängen der SPD-Vertreter den Abbruch des Streiks zum 4. Februar. Allein in Berlin wurden umgehend etwa 50.000 Streikende eingezogen, gegen 200 „Rädelsführer“ verhängten Kriegsgerichte zum Teil empfindliche Freiheitsstrafen. Der Januarstreik, als solcher zweifellos ein Misserfolg, hatte allerdings auch zu einer Festigung des strukturellen Übergewichts der USPD in der Reichshauptstadt geführt und die Militanz der Aktivisten eher verschärft als gebremst.[57] Friedrich Ebert hatte – offenbar schlecht beraten – auf einer großen Streikversammlung im Treptower Park (auf der Wilhelm Dittmann verhaftet und von Polizisten mit Säbeln traktiert wurde)[58] eine mit nationalistischen Tönen durchsetzte Rede gehalten und war von Zwischenrufern als „Arbeiterverräter“ und „Streikabwürger“ geschmäht worden, die SPD verlor in den Berliner Großbetrieben in der Folge weiter an Einfluss.[59]
In den auf den Streik folgenden Monaten wirkte die USPD vor allem durch die in ihrer Presse nachgedruckten Wortmeldungen der Reichstagsabgeordneten auf die politische Entwicklung ein. Zahlreiche lokale Aktivisten hatten darüber hinaus Anteil an der auf niedrigerem Niveau andauernden Streikwelle, die zwischen Juni und September noch einmal erhebliche Ausmaße erreichte. Die Reichstagsfraktion der USPD sprach sich – als einzige – geschlossen gegen den Friedensvertrag von Brest-Litowsk aus und nahm bei mehreren Gelegenheiten uneingeschränkt Partei für Sowjetrussland. Als die SPD Anfang Oktober 1918 in die Reichsregierung eintrat, wurde das von der USPD in einem Aufruf scharf kritisiert:
- „Die Sozialdemokratische Partei ist in die Regierung berufen, um nach dem Zusammenbruch des Imperialismus die bürgerliche Gesellschaft zu schützen. Sie hat die Aufgabe übernommen, die ‚nationale Verteidigung‘ zu organisieren und die bürgerliche ‚Ordnung‘ zu schützen. Sie hat die Forderung der internationalen Kongresse preisgegeben, dass die Katastrophe des Weltkrieges von der Sozialdemokratie ausgenützt werden müsse, an die Stelle des kapitalistischen Systems das sozialistische zu setzen.“[60]
Die „Parole des deutschen Proletariats“ sei stattdessen die „Einigkeit unter dem unbefleckten Banner der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei.“[60] In einigen Städten gingen USPD-Mitglieder im Oktober 1918 offensiv gegen Kundgebungen bürgerlicher Parteien vor, auf denen zum „Durchhalten“ und zur „nationalen Verteidigung“ aufgerufen wurde. In Essen wurde eine solche Versammlung „gleich zu Beginn von den Unabhängigen gesprengt“, die „Hochrufe auf Liebknecht [ausbrachten], Verse vom Sozialistenmarsch [sangen] und ganze Haufen von Flugblättern in den Saal [warfen].“[61] Derartige Erklärungen und Aktionen verdeckten allerdings, dass die USPD keineswegs in der Lage war, auf die nun einsetzende Krise der alten Ordnung klar, gefestigt und einheitlich zu reagieren. Auf ihrer Oktoberkonferenz, an der erstmals auch Angehörige der nicht in der USPD vertretenen linksradikalen Gruppen aus Norddeutschland teilnahmen, hatte die Spartakusgruppe einige der innerparteilichen Sollbruchstellen markiert.[62] Am Vorabend der Revolution hatten sich die USPD-Mitglieder selbst in wesentlichen Grundfragen nur lose und – wie sich schon bald zeigte – wenig belastbar verständigt, die unentschlossene Führungsgruppe der Partei war dem SPD-Vorstand, der zumindest genau wusste, was er nicht wollte, taktisch unterlegen und hegte zudem Illusionen über dessen politische Absichten.[63]
Die Rolle der USPD in der Novemberrevolution
Die revolutionäre Krise und der Entschluss zum Eintritt in die Regierung
Während die SPD als Regierungspartei den am 4. August 1914 eingeschlagenen Kurs zunächst fortsetzte, zur Zeichnung der nunmehr neunten Kriegsanleihe aufrief und noch Ende Oktober gemeinsam mit bürgerlichen Parteien gegen die „Flaumacher“ agitierte,[64] erlangte in der USPD erneut jene Strömung größeren Einfluss, die im Vorfeld des Januarstreiks außerparlamentarische Aktionen gefordert hatte, nach dessen Niederschlagung aber vorübergehend in den Hintergrund getreten war. Auch die Spartakusgruppe konnte sich nun auf eine beachtliche Massenbasis stützen. Am 23. Oktober 1918 kehrte der amnestierte Karl Liebknecht nach Berlin zurück und wurde am Anhalter Bahnhof von etwa 20.000 spontan herbeigeeilten Menschen begeistert empfangen. Zwei Tage später beschloss der USPD-Vorstand, Liebknecht in das Gremium zu kooptieren; dabei wurde ihm zugesichert, dass die „Entwicklung der USP (…) zu einer vollständigen Übereinstimmung mit den Anschauungen der Gruppe Internationale geführt habe.“[65] Liebknecht sagte seine Mitarbeit unter der Bedingung zu, dass die USPD auf einem schnellstmöglich einzuberufenden Parteitag eine Klärung über ihren Kurs herbeiführe und die Parteiführung entsprechend umgestalte (ein Beschluss hierüber wurde vor der Revolution nicht mehr gefasst). Liebknecht befand sich nun auf dem Höhepunkt strömungsübergreifender Popularität innerhalb der USPD, von prominenten Parteirednern wurde er mehrfach als zukünftiger Präsident einer deutschen sozialistischen Republik bezeichnet.[66]
Von Ort und Zeitpunkt des Beginns der offenen Aufstandsbewegung (vgl. Kieler Matrosenaufstand) wurde die USPD-Führung überrascht. Anders als die Reichsregierung, die auf Vorschlag des Marinestaatssekretärs Ritter von Mann sofort Gustav Noske und Conrad Haußmann nach Kiel entsandte, um die Bewegung unter Kontrolle zu bringen, unterschätzte sie zunächst die Bedeutung der Ereignisse.[67] Ein Telegramm, mit dem die Matrosen Haase, Ledebour oder Oskar Cohn nach Kiel gerufen hatten, war zurückgehalten worden. Haase traf erst am Abend des 7. November – drei Tage nach Noske – in Kiel ein, griff nicht mehr in die Ereignisse ein und reiste wenige Stunden später wieder ab.
Nach Liebknechts Rückkehr hatte sich unter den drei Berliner USPD-Richtungen eine kontroverse Debatte über das weitere Vorgehen entwickelt. Die Spartakusgruppe wollte die Massen durch eine sukzessiv gesteigerte Abfolge von Kundgebungen und Demonstrationen schrittweise an die revolutionäre Machtübernahme heranführen. Die Vertreter des Parteivorstands waren zur Veranstaltung von Kundgebungen bereit, schreckten aber vor Demonstrationen und jeder weiteren bewusst herbeigeführten Eskalation zurück. Die streng konspirativ tätigen Obleute hatten ein rein technisches Verhältnis zu dieser Problematik und lehnten die Spartakus-Vorschläge als „revolutionäre Gymnastik“ ab. Ihr Ansatz lief, wie Liebknecht enttäuscht notierte, auf ein „‚Alles oder nichts‘ – also nichts“[65] hinaus; auch Liebknechts wiederholte Hinweise auf die „Gefahr, dass sich die Scheidemänner der Bewegung bemächtigen“,[68] beeindruckten sie zunächst nicht. Am 2. November beschloss eine Versammlung der Obleute und der Spartakus-Vertreter, in der Reichshauptstadt am 4. November den Generalstreik und den offenen Aufstand zu wagen. Noch am gleichen Abend wurde dieser Termin auch auf Drängen Haases und Dittmanns, die herbeigeeilt waren, auf den 11. November verschoben.[69] Kurz darauf begannen die Behörden, gegen die Berliner USPD vorzugehen. Seit dem 4. November fanden Verhaftungen statt, die Sitzung der Obleute – die sich inzwischen als „Arbeiterrat“ konstituiert hatten – am 6. November wurde von der Polizei auseinandergetrieben, mehrere Großbetriebe wurden wie schon im Januar militärisch besetzt, die von der Partei für den 7. November geplanten Veranstaltungen zum Jahrestag der russischen Revolution wurden ausnahmslos verboten. Am 8. November durchsuchte die Polizei das Gebäude des Parteivorstands am Schiffbauerdamm und verhaftete den mit der Planung für den 11. November befassten Ernst Däumig, andere prominente Parteiführer wurden auf Schritt und Tritt überwacht.[70] Damit war die USPD in Berlin faktisch illegalisiert. Erst unter dem Eindruck dieser Verfolgungsmaßnahmen waren die Obleute und einige führende Mitglieder der USPD am Abend des 8. November schließlich dazu bereit, gemeinsam mit der Spartakusgruppe auf Flugblättern für den 9. November zum Generalstreik, zu Großdemonstrationen im Stadtzentrum und zur Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten aufzurufen. Dass dieser improvisierte Entschluss binnen weniger Stunden vollständig umgesetzt werden konnte, dokumentiert das hohe Maß an Autorität und Ansehen, das die USPD zu diesem Zeitpunkt genoss. Dies wurde gerade auch von Friedrich Ebert klar erkannt, der den Reichskanzler am 7. November warnend darauf hinwies, dass „uns die ganze Gesellschaft zu den Unabhängigen [läuft]“,[71] falls nicht unverzüglich die Abdankung des Kaisers in Aussicht gestellt werde.
Als am Morgen des 9. November hunderttausende Menschen in das Berliner Stadtzentrum strömten, Bahnhöfe, Brücken und wichtige öffentliche Gebäude von bewaffneten Arbeitern und Soldaten besetzt wurden, fand sich ein Großteil der führenden USPD-Mitglieder im Reichstagsgebäude ein. Dittmann und Ledebour hatten aus Furcht vor einer Verhaftung bereits die Nacht dort verbracht. Haase war noch nicht aus Kiel zurück. Eine politische Konzeption für den Umgang mit der neuen Situation war in diesem Kreis, der das Geschehen völlig passiv beobachtete, nicht vorhanden. Dittmann glaubte nicht an einen sofortigen Erfolg der Massenaktionen und rechnete ernstlich mit einem monatelangen Bürgerkrieg.[72] Nun wirkte sich die überlegene „Kaltblütigkeit und organisatorische Regie“[73] der SPD-Führung voll aus. Noch am Vormittag erschien überraschend eine Delegation (Ebert, Scheidemann und David) im Zimmer des Fraktionsvorstands der USPD und unterbreitete den verblüfften Anwesenden das Angebot, gemeinsam die Regierung zu übernehmen. Ledebour soll zunächst fast sprachlos gewesen sein und lediglich „Ach, na so was!“ ausgerufen haben.[74] Dittmann hat die Situation später so beschrieben:
- „Wir waren unerwartet vor eine Entscheidung gestellt, an die niemand von uns gedacht hatte. Unsere Massenstreikaktion, die in vollem Gange war, richtete sich gegen die Regierung und damit notwendigerweise auch gegen die nach unserem Wissen noch in ihr vertretene mehrheitssozialistische Partei. […] Eben noch auf der politischen Gegenseite, jetzt mit uns in derselben Front, und dazu auch noch das Angebot der gemeinsamen Regierung! Das war ein plötzlicher totaler Wechsel der Situation, der völlig überraschend kam. […] Die Verantwortung für uns einzelne, die wir zur Stelle waren, war eine ungeheure. Die Stimmung neigte sich bei unsern Freunden immer mehr nach der Seite einer Zustimmung zu dem Angebot der Mehrheitssozialisten, von denen berichtet wurde, dass sie in der Reichskanzlei bereits ein und aus gingen, als ob sie die Regierung bereits übernommen hätten.“[75]
Wenige Stunden später wurde bekannt, dass Max von Baden Ebert das Amt des Reichskanzlers übertragen hatte. Ebert war bewusst, dass er zu diesem Zeitpunkt ohne oder gar gegen die USPD – gestützt allein auf die „Legitimation“ durch den letzten vom Kaiser ernannten Reichskanzler – keine handlungsfähige Regierung bilden konnte. Die SPD-Unterhändler stellten die USPD-Vertreter daher am Abend vor die Alternative, entweder selber die Regierung zu übernehmen oder auf paritätischer Grundlage mit der SPD zusammenzuarbeiten.[66] Parallel ließ Ebert die beabsichtigte Bildung einer gemeinsamen Regierung in einem Flugblatt öffentlich bekanntmachen und setzte die USPD damit zusätzlich unter Druck. Schon zur Mittagszeit hatte die SPD einen Aufruf verbreitet, in dem behauptet wurde, dass sie die Massenbewegung zusammen mit der USPD leite.[76] Unter dem maßgeblichen Einfluss Liebknechts – der zunächst jede Unterhandlung mit den „Kaisersozialisten“ schroff abgelehnt hatte, auf Drängen mehrerer Soldatendelegationen seine Position nun aber etwas modifizierte[77] – formulierte die USPD-Führung daraufhin mehrere Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung (Deutschland sozialistische Republik, alle Macht bei den Arbeiter- und Soldatenräten, Entlassung der bürgerlichen Staatssekretäre, gemeinsame Regierung nur bis zum Abschluss des Waffenstillstands). Dieses radikale Programm wurde vom SPD-Vorstand postwendend abgelehnt. Liebknecht zog sich anschließend aus den Verhandlungen zurück und überließ dem inzwischen in Berlin eingetroffenen Haase – der eine Zusammenarbeit mit der SPD in einer ersten emotionalen Reaktion ebenfalls abgelehnt, dann aber rasch akzeptiert hatte – das Feld. Unter Haases geschickter Federführung kam am frühen Nachmittag des 10. November trotz des Widerstands der Obleute und Ledebours eine Einigung mit der SPD zustande. Die neuen Bedingungen der USPD stellten sich zwar einigermaßen nachdrücklich hinter die Institution der Arbeiter- und Soldatenräte, schlossen die Einberufung einer Nationalversammlung aber nicht mehr prinzipiell aus.[78]
Mit der in letzter Minute erzielten Einigung durchkreuzten USPD- und SPD-Vorstand gemeinsam das Kalkül der Obleute und der Spartakus-Gruppe, die einen Augenblick lang gehofft hatten, auf der für den Abend des 10. November in den Zirkus Busch einberufenen Vollversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte eine radikal linke Regierung etablieren zu können. Durch die unter die zugkräftigen Parolen „Einigkeit der Sozialisten“ und „Kein Bruderkampf“ gestellte Bildung einer gemeinsamen Regierung der Arbeiterparteien „war ein Fait accompli geschaffen, über das sich die Zirkus-Busch-Versammlung nicht ohne weiteres hinwegsetzen konnte.“[79] In der Räteversammlung warben Haase und Ebert für die „sozialistische Regierung“, deren Existenz und Zusammensetzung von den Delegierten zuletzt mit großer Mehrheit bestätigt wurde (vgl. Rat der Volksbeauftragten). Die Zusammensetzung des ebenfalls im Zirkus Busch gewählten Vollzugsrates, dessen USPD-Mitglieder alle den Obleuten bzw. der Ledebour-Gruppe nahestanden, und der von Tumulten begleitete Auftritt Liebknechts, der mit Blick auf die mehrheitssozialdemokratischen Volksbeauftragten ausrief, dass „die Gegenrevolution […] bereits auf dem Marsche, […] bereits in Aktion, […] bereits hier unter uns“[80] sei, beleuchteten schlaglichtartig die grundsätzlichen Differenzen innerhalb der USPD, die wenige Wochen später die erste Parteispaltung herbeiführten.
Die USPD als Regierungspartei im Reich und in den Einzelstaaten
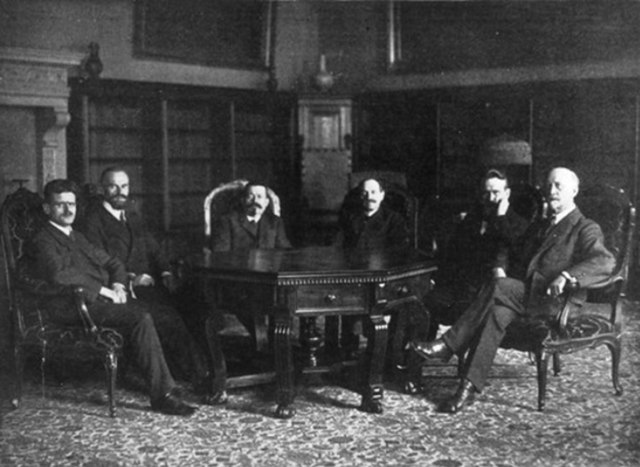
Das Verhältnis der USPD-Führer zu der ihnen gleichsam zugefallenen politischen Macht war zunächst weitgehend unklar. Sie hatten derartige Einflusspositionen nicht aktiv angestrebt und verfügten über kein adäquates Aktionsprogramm, ihr Verhältnis zur Rätebewegung war nicht frei von Unsicherheit und Widersprüchen. Das große Druckpotential, das ihnen ihr zunächst noch überragender Einfluss auf die Massenbewegung gesichert hatte, konnten sie so zu keinem Zeitpunkt einsetzen. Eine weitere Ursache für die relative Passivität der USPD in den folgenden Wochen war, dass ein Teil der Partei nach dem 9. November 1918 subjektiv ehrlich davon überzeugt war, dass die „sozialistische Republik“ bereits erkämpft und der Einfluss der Arbeiter- und Soldatenräte – deren Stellung zum parlamentarischen Repräsentativsystem bislang kaum geklärt worden war – gesichert sei. Diese Haltung kam im Aufruf der USPD vom 12. November deutlich zum Ausdruck. Außerdem empfanden einzelne Parteiführer – vor allem aber diejenigen Parteimitglieder, die auf ein Weitertreiben der Revolution drängten – die unvermittelte regierungsamtliche Zusammenarbeit mit der SPD, deren Führungsspitze bis zum letzten Augenblick gegen die revolutionäre Bewegung aufgetreten war und sich dann übergangslos an deren Spitze gestellt hatte, von Anfang an als „groteske Situation“[81] Haase, Dittmann und Emil Barth traten im Rat der Volksbeauftragten nicht zuletzt wegen dieser atmosphärischen Distanz deutlich zurückhaltender auf als die drei Vertreter der SPD.[82] Dazu kam, dass Ebert, Scheidemann und Landsberg von den Staatssekretären und Beamten weitgehend akzeptiert, die USPD-Vertreter aber nach Kräften ignoriert, mitunter sogar demonstrativ zurückgesetzt wurden. So weigerte sich Wilhelm Solf, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Hugo Haase (der im Rat der Volksbeauftragten formell die Verantwortung für die Außenpolitik übernommen hatte) auch nur zu grüßen.[83] Der preußische Kriegsminister Heinrich Schëuch drehte Emil Barth bei einem ersten Zusammentreffen den Rücken zu, als dieser ihn ansprach, und begegnete nach der Aufzeichnung eines Augenzeugen auch Haase mit „frostig kühle[r] Abweisung“[84]. Auch diese höchst selektive Kooperation seitens des intakt gebliebenen alten Staatsapparats ermöglichte es Ebert, fast reibungslos als gleichsam inoffizieller Reichskanzler zu agieren und „die Teilnahme der drei USPD-Mitglieder am Rat der Volksbeauftragten fast zur Bedeutungslosigkeit herab[zu]drücken.“[85] In der Praxis wurden nicht wenige Sachverhalte ohne Konsultation der USPD-Volksbeauftragten entschieden, gelangten erst spät oder auch gar nicht zu deren Kenntnis. Das galt insbesondere für Eberts fortlaufende Absprachen mit der OHL und dem preußischen Kriegsministerium, deren Inhalt und Zweck – nach Wilhelm Groeners beeideter Aussage von 1925 war dies „die restlose Bekämpfung der Revolution, Wiedereinsetzung einer geordneten Regierungsgewalt, Stützung dieser Regierungsgewalt durch die Macht einer Truppe, und baldigste Einberufung einer Nationalversammlung“[86] – völlig unvereinbar mit der politischen Linie der USPD war und im Falle des Bekanntwerdens das sofortige Ausscheiden der USPD-Volksbeauftragten unausweichlich gemacht hätte.[87]
Diese sehr ungleiche „Parität“ bildete das offizielle Regierungsprogramm, das am 12. November 1918 veröffentlicht wurde, bereits vollständig ab. Obwohl als „sozialistisch“ deklariert, ging es an keinem Punkt über die politische Plattform hinaus, die in den Jahren zuvor vom rechten Flügel der SPD und reformbereiten Kräften der Fortschrittlichen Volkspartei und des Zentrums erarbeitet worden war.[88] Vor allem aber unterstellte es ohne weitere Erörterung als selbstverständlich, dass es zur Wahl einer konstituierenden Nationalversammlung kommen werde, obwohl die Entscheidung über diese höchst umstrittene Frage formal beim Berliner Vollzugsrat lag. Dieser beschloss am 17. November, einen Delegiertenkongress der Arbeiter- und Soldatenräte abschließend mit dieser Frage zu befassen (vgl. Reichsrätekongress). Während nicht nur der Spartakusbund, sondern auch andere einflussreiche USPD-Linke wie Richard Müller und Ernst Däumig den „Schrei nach der Nationalversammlung“ als „Weg zur Herrschaft der Bourgeoisie“ und „Sammelruf aller gegenrevolutionären kapitalistischen Kreise“[89] kritisierten, diskutierten Haase, Dittmann und – mit den für ihn typischen Schwankungen – auch Barth trotz fortlaufender öffentlicher Bekenntnisse zu den Arbeiter- und Soldatenräten schon zu diesem Zeitpunkt intern nur noch über den Termin einer solchen Wahl. Dabei versuchten sie, einen möglichst späten Zeitpunkt durchzusetzen; zuvor sollte erst die Rückführung und Demobilisierung der Fronttruppen abgeschlossen und eine gewisse Konsolidierung der durch die Revolution geschaffenen Machtverhältnisse erreicht werden.[90] Dagegen forderten die SPD-Vertreter – und daneben in einer rasch anlaufenden Kampagne große Teile der Presse und alle bürgerlichen Parteien – eine zeitnahe Durchführung im Januar oder Februar 1919. Nach zeitweise heftigen Auseinandersetzungen konnten sie sich damit am 29. November im Rat der Volksbeauftragten durchsetzen. Mit der schon am nächsten Tag veröffentlichten Verordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung wurde wie schon bei der Regierungsbildung am 10. November erneut ein Fait accompli geschaffen, das die Entscheidung einer Räteversammlung im Sinne der sozialdemokratischen Rechten vorwegnahm. Charakteristisch für die schwankende, nicht nur in dieser Frage widersprüchliche Linie der USPD-Volksbeauftragten war, dass die Parteiführung erst drei Tage zuvor in einem Aufruf die „verdächtige Eile“ kritisiert hatte, mit der die Einberufung der Nationalversammlung betrieben werde; dahinter stecke die Absicht, „alle tiefgreifenden, sozialen Umgestaltungen“[91] durch die aus der Revolution hervorgegangenen Machtorgane zu verhindern.
Konstellation und Ergebnis der Debatte über die Nationalversammlung reproduzierten sich bei den Beratungen der Volksbeauftragten immer wieder. Die politische Initiative lag weitgehend bei den SPD-Vertretern; Haase, Dittmann und Barth beschränkten sich in der Regel darauf, deren Vorstöße mit Rücksicht auf Positionen der USPD zu modifizieren. Im Ergebnis bedeutete dies, dass die USPD die Linie der SPD dem Wesen nach mittrug. Eine der wenigen weitreichenden Weichenstellungen, die die USPD-Volksbeauftragten durchsetzen konnten, betraf das deutsch-polnische Verhältnis. Am 28. Dezember 1918 verhinderten Haase, Dittmann und Barth eine von Ebert, Scheidemann und Landsberg befürwortete deutsche Kriegserklärung an Polen.[92] Selbständige Anliegen der USPD in innenpolitischen Fragen versandeten dagegen regelmäßig. Das galt etwa für den gleich in den ersten Tagen der Tätigkeit des Rates der Volksbeauftragten gestellten Antrag der Unabhängigen, das alte Heer restlos zu demobilisieren und – im Sinne des Erfurter Programms von 1891 – eine demokratische Volkswehr zu schaffen. Ebert und Schëuch lehnten dies mit dem Argument ab, dass die Arbeiter kriegsmüde seien und keine Lust darauf hätten, weiterhin Militärdienst zu leisten.[93]
Die Berliner Weihnachtskämpfe setzten der Regierungsbeteiligung der USPD ein Ende. Einerseits wurde der Gruppe um Haase nach diesen Ereignissen klar, dass sie bei einem weiteren Verbleib in der Regierung ihren politischen Einfluss innerhalb der USPD aufs Spiel setzte. Emil Barth war von den Obleuten bereits am 21. Dezember das Misstrauen ausgesprochen worden.[94] Eine Woche später kam es bei der Aufstellung der Berliner USPD-Kandidatenliste für die Wahl zur Nationalversammlung zum Eklat, als sich Ledebour, Däumig und Richard Müller weigerten, auf einer Liste mit Haase zu kandidieren und diesem zudem nur der zweite Listenplatz (nach Emil Eichhorn) zugesprochen wurde. Andererseits war Haase auch unabhängig vom Druck des linken Parteiflügels zu der Überzeugung gekommen, dass eine weitere Kooperation mit den SPD-Volksbeauftragten nicht mehr zu rechtfertigen war. Nach dem Zeugnis Dittmanns war die Atmosphäre im Rat der Volksbeauftragten nach den Weihnachtstagen „frostig-eisig“, als Ebert wiederholt versicherte, „keine Ahnung“ davon zu haben, wie es zu dem Angriff auf die Volksmarinedivision gekommen war; nach dieser – so Dittmann – „krassen Unwahrhaftigkeit und Hinterhältigkeit von Ebert, Scheidemann und Landsberg“[95] sah auch der „immer konziliante Haase“[96] keinerlei Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit. Am 28. Dezember brachten die drei Unabhängigen diese Angelegenheit im Zentralrat zur Sprache, der ihnen in der Sache zwar teilweise entgegenkam, die implizit verlangte Abberufung bzw. Auswechslung der SPD-Vertreter aber ablehnte. Daraufhin gab Haase in den frühen Morgenstunden des 29. Dezember 1918 vor dem Zentralrat den Rücktritt der USPD-Volksbeauftragten bekannt.
Ähnlich fruchtlos wie auf der Reichsebene war auch die Tätigkeit der USPD in den Regierungen der Einzelstaaten. Oft war das eigenständige Profil ihrer Vertreter hier noch geringer als im Rat der Volksbeauftragten.[97] Eine ausgesprochene Ausnahme war der preußische Kultusminister Adolph Hoffmann, dessen energische Maßnahmen zur Trennung von Staat und Kirche auf den Protest der konservativen und klerikalen Presse trafen und auch von Konrad Haenisch, mit dem Hoffmann sich das Amt teilte, wo möglich blockiert wurden. Das Bild der USPD-Politik im November und Dezember 1918 prägten aber nicht vergleichsweise selbstbewusste Persönlichkeiten wie Hoffmann, sondern die auf strikte Legalität bedachten USPD-Mitglieder der Haase-Richtung, die nahezu überall die Regierungsarbeit der USPD gestalteten. Das galt insbesondere für Sachsen und Preußen, wo sich schon nach wenigen Tagen ein ausgeprägter Dualismus zwischen dem gouvernementalen Parteiflügel – zu dessen führendem Kopf sich binnen weniger Wochen Rudolf Hilferding entwickelte – und den Räteaktivisten abzeichnete. Wo dagegen der Einfluss des radikalen Flügels überwog, unternahm die Partei mitunter weitreichende Vorstöße, die über eine einfache Übernahme von Regierungsverantwortung hinausgingen. In Hamburg konnte sie am 12. November 1918 gegen den erbitterten Widerstand der SPD die (vorübergehende) Auflösung von Senat und Bürgerschaft durchsetzen. Auch im ehemaligen Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha löste die lokale Parteiführung zunächst den Landtag sowie alle Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindeausschüsse auf. Ein Sonderfall war Bayern, wo die USPD mit Kurt Eisner einen Regierungschef stellte, der persönlich sowohl dem radikalen als auch dem zentristischen Flügel seiner Partei gleichermaßen fremd gegenüberstand.
Die Krise der USPD-Politik und die Abspaltung des Spartakusbundes
Bereits zu diesem Zeitpunkt (1. Januar 1919) hatte sich die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) unter Führung von Liebknecht und Luxemburg gegründet.
Im folgenden Januaraufstand (5.–12. Januar 1919) gewann die USPD kurzfristig eine Massenbasis durch die Eigenaktivität der Berliner Arbeiterschaft. Diese besetzten das Berliner Zeitungsviertel und riefen den Generalstreik aus, dem etwa 500.000 Menschen folgten. Im Führungsgremium bejahten Haase und Liebknecht nun eine Bewaffnung der Berliner Arbeiter, vor der Rosa Luxemburg zuvor entschieden gewarnt hatte. Versuche, Teile des revolutionsfreundlichen Militärs für einen bewaffneten Aufstand zu gewinnen, schlugen fehl.
Am 9. Januar setzte Ebert nach Abbruch ergebnisloser Verhandlungen zunächst reguläres Militär in Marsch. Bei den folgenden Häuserkämpfen erlitten die Besetzer schwere Verluste und gaben auf. Hunderte wurden dennoch an Ort und Stelle erschossen. Am 12. Januar zogen schließlich zusätzlich schwer bewaffnete Freikorps in die Stadt ein, die seit Anfang Dezember aufgestellt worden waren. Im Gefolge von Mordaufrufen und ausgesetzten Belohnungen wurden führende Mitglieder sowohl der Spartakisten als auch der USPD ermordet: darunter Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches und Wolfgang Fernbach.
Die USPD in der Gründungsphase der Weimarer Republik

Gemessen an den im Vorfeld von der USPD-Führung geäußerten Erwartungen war die am 19. Januar 1919 stattfindende Wahl zur Nationalversammlung eine gewaltige Enttäuschung. Die Warnung Rosa Luxemburgs, dass dieses Parlament unter den gegebenen Bedingungen nichts anderes als „eine gegenrevolutionäre Festung“ sein könne, war von Rudolf Hilferding, der im November 1918 die Leitung des neuen USPD-Zentralorgans Freiheit übernommen hatte, als „kleinmütiges Zweifeln“ zurückgewiesen worden.[98] Intern rechnete man allenfalls damit, dass das erstmals praktizierte Frauenwahlrecht eher die konservativen Parteien und die SPD als die USPD begünstigen werde. Skeptische Stimmen wie die Rudolf Breitscheids, der mit Blick auf den unfertigen Zustand der Parteiorganisation angemerkt hatte, dass die Wahl „nach meinem Dafürhalten viel zu früh“[99] stattfinde, wurden überhört. Die Spartakusgruppe und USPD-Mitglieder, die eine Räterepublik wollten, riefen zum Boykott der Wahlen auf. Bei der Wahl kam die USPD dann völlig überraschend nur auf 7,6 % der Stimmen, während die SPD knapp 38 % erhielt und – was aus Sicht der USPD noch schwerer wog – die bürgerlichen Parteien zusammen 16,5 Millionen Wähler anzogen, SPD und USPD dagegen nur 13,8 Millionen. Die „sozialistische Mehrheit“, die die Gruppe um Kautsky vor der Wahl noch für „absolut sicher“ erklärt hatte, erwies sich – zusammen mit der damit einhergehenden Annahme, eine Neuauflage des Rates der Volksbeauftragten in Gestalt einer SPD-USPD-Koalition stehe vor der Tür – als genauso illusionär wie die von den gleichen Autoren vertretene Auffassung, dass die „reine Demokratie“ den Arbeiterparteien automatisch die Mehrheit sichere.[100] Für viele Wähler war im Januar 1919 nicht mehr erkennbar, was die USPD, die noch wenige Wochen vor der Wahl im Reich und in mehreren Einzelstaaten mit der SPD zusammengearbeitet hatte und genau wie diese in ihrer Presse die Nationalversammlung als notwendigen Schritt hin zum Sozialismus darstellte, eigentlich von der Mehrheitssozialdemokratie unterschied. Erst im Februar begann die USPD, die Ebert-Regierung und den bis dahin unverdrossen als „sozialistische“ oder zumindest „soziale Republik“ besprochenen neuen Staat als „bürgerlich“ anzugreifen.[101]
Die Januarwahl geriet so zu einer deutlichen Zäsur für die USPD. Die bis dahin im Kern unangefochtene Führungsposition des Kreises um Haase erodierte in dem Maße, in dem offensichtlich wurde, wie erschreckend wenig die Partei in den Wochen und Monaten nach dem 9. November 1918 erreicht hatte. Eine explizit sozialistisch-revolutionäre, ganz auf die Räte orientierte Strömung, zu deren Sprecher der ehemalige Vorwärts-Redakteur Ernst Däumig wurde, gewann nun – nur wenige Wochen, nachdem sich der Spartakusbund und mit ihm viele Schlüsselfiguren der Parteilinken von der USPD getrennt hatten – binnen kurzer Zeit an Kontur und Einfluss. Dass die USPD bei dieser Wahl so sehr in die Hinterhand geriet, hatte neben politischen allerdings auch – wie von Breitscheid befürchtet – einfache organisatorische Gründe. Sie war bis zu diesem Zeitpunkt immer noch eine reine, in der Fläche gar nicht oder nur sehr schwach präsente Metropolenpartei;[34] erst nach dem Wahldesaster anerkannte die Parteiführung die Notwendigkeit, die Partei auch in kleineren Städten sowie auf dem Lande organisatorisch zu verankern (bei den Landtagswahlen in Anhalt und Mecklenburg-Strelitz am 15. Dezember 1918, den ersten Parlamentswahlen nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches überhaupt, war die USPD mangels arbeitsfähiger Strukturen erst gar nicht angetreten). In den wenigen Wahlkreisen, in denen die USPD über eine flächendeckend schlagkräftige Organisation verfügte, schnitt sie am 19. Januar vergleichsweise gut ab: Im Wahlkreis 13 (Regierungsbezirk Merseburg) erhielt sie 44,1 %, im Wahlkreis 29 (Stadt- und Landkreis Leipzig, Döbeln, Oschatz, Grimma, Borna) 38,6 % der Stimmen. In Berlin (Wahlkreis 3), wo die Infrastruktur der Partei nach den Januarkämpfen am Boden lag und die Wahl in einer Atmosphäre des Ausnahmezustands stattfand, kam sie immerhin noch auf 27,6 %. Diesen Erfolgen stand allerdings eine lange Reihe katastrophaler Ergebnisse wie in den Wahlkreisen 25 (Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz) und 7 (Provinz Pommern) gegenüber, wo die Partei lediglich 0,5 % bzw. 1,9 % der Stimmen erhalten hatte.[102] Bei der Zumessung der Mandate profitierten die jeweils stärksten Parteien im Wahlkreis überproportional, was sich zusätzlich zu Ungunsten der USPD auswirkte. Letztlich erhielt sie nur 22 Sitze und damit zehn weniger, als ihr nach dem exakten reichsweiten Stimmenanteil zugestanden hätten.[103]
In der Weimarer Nationalversammlung war die USPD-Fraktion von Anfang an politisch isoliert, umgekehrt aber nun auch gewillt, einen Kurs scharfer Opposition einzuschlagen. Haase hatte sich bereits vor dem erstmaligen Zusammentreten der Nationalversammlung darauf festgelegt, eine eventuell angebotene Regierungsbeteiligung abzulehnen. Albert Südekum wies Ebert am 1. Februar in einem Privatbrief auf diesbezügliche „absolut zuverlässige Informationen“[104] hin.[105] Mit diesem Wissen und in der Absicht, die USPD, wie er Conrad Haußmann gegenüber erläuterte, „ins Unrecht“ zu setzen,[106] unterstützte Ebert – zur Verblüffung von Parteirechten wie Eduard David – in der SPD-Fraktion die Anregung Adolf Brauns, der USPD ein Koalitionsangebot zu unterbreiten. Die Absage der USPD lag am 6. Februar vor:
- „Für die Fraktion der USPD kommt der Eintritt in die Regierung solange nicht in Frage bis die gegenwärtige Gewaltherrschaft beseitigt ist und bis die sämtlichen Mitglieder der Regierung nicht nur das Bekenntnis ablegen, sondern auch den entschlossenen Willen betätigen, die demokratischen und sozialistischen Errungenschaften der Revolution gegen die Bourgeoisie und die Militärautokratie sicherzustellen.“[107]
Diese „Verweigerungshaltung“ der USPD wurde von der SPD-Führung in den folgenden Monaten immer wieder zur Rechtfertigung der eigenen Koalitionspraxis herangezogen; dabei verschwieg sie, dass sie sich zum Zeitpunkt der Offerte an die USPD bereits im Grundsatz mit der DDP auf eine Regierungsbildung verständigt hatte und das Angebot von vornherein darauf berechnet war, zurückgewiesen zu werden.[108] Hauptsprecher der USPD-Fraktion in Weimar waren neben Haase Oskar Cohn, Alfred Henke und Emanuel Wurm. Als am 10. Februar die „Notverfassung“ – das Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt – beraten wurde, wies Cohn darauf hin, dass in dem von der USPD abgelehnten Entwurf weder das Wort „Revolution“ noch das Wort „Republik“ auftauche („Ist das ein Zufall, geehrte Versammlung?“).[109] Die Abänderungsvorschläge der USPD – Staatsbezeichnung Deutsche Republik statt Deutsches Reich, Abschaffung des Staatenausschusses, Ersetzung des Reichspräsidenten durch ein mehrköpfiges Präsidium, Volksabstimmungen über Gesetze im Falle eines Vetos durch ein noch zu schaffendes Zentralorgan der Arbeiter- und Soldatenräte – wurden sämtlich und in der Regel ohne Diskussion niedergestimmt.[110] Am 27. Februar votierten nur die USPD-Abgeordneten gegen das Gesetz über die Bildung einer vorläufigen Reichswehr, auf dessen Grundlage in den folgenden Monaten mehrere Freikorps-Verbände in Reichswehr-Brigaden umgewandelt und die Soldatenräte endgültig abgeschafft wurden.[111]
Den großen, hier und da in bewaffnete Auseinandersetzungen übergehenden Streikbewegungen im Frühjahr 1919 (im Ruhrgebiet im Februar und April, im mitteldeutschen Industriegebiet Ende Februar/Anfang März, in Berlin Anfang März, in Oberschlesien im März und April, in Württemberg Anfang April) stand die USPD-Führung weitgehend ratlos gegenüber. Diese Streiks wurden wesentlich von Anhängern, Mitgliedern und Funktionären der USPD getragen und richteten sich oftmals gegen die Entmachtung der örtlichen Arbeiterräte durch die nun in ein Industriezentrum nach dem anderen entsandten Freikorps. Da sich die Parteispitze konzeptionell vom „reinen“ Rätesystem distanziert hatte – Hilferding schrieb in der Freiheit immer noch gegen die Losung „Alle Macht den Räten!“ an[101] – blieb ihr wenig mehr übrig, als gegen das gewaltsame Vorgehen der Regierungstruppen mündlich und schriftlich zu protestieren. Diese Haltung nahm die Parteiführung auch anlässlich der Zerschlagung der Räterepubliken in Bremen und München ein. Dass dieses betont legale Auftreten von Verantwortungsträgern in Politik und Verwaltung nur sehr bedingt goutiert wurde, bewies unter anderem die Stadtverordnetenwahl in Halle am 2. März: Hierbei entfiel ein Großteil der Mandate auf die USPD, woraufhin die alte Stadtverordnetenversammlung die Wahl auf Geheiß von Oberbürgermeister Rive kurzerhand für ungültig erklärte.[112]
Vom 2. bis zum 6. März 1919 beriet im ehemaligen preußischen Herrenhaus unter dramatischen äußeren Bedingungen (vgl. Berliner Märzkämpfe) ein außerordentlicher Parteitag über den bisherigen und zukünftigen Kurs der USPD. Nach dem politischen Bankrott im Rat der Volksbeauftragten und dem Debakel bei der Januarwahl hatte sich die Parteiführung, die eine Spaltung und den Übertritt größerer Teile der USPD zur KPD befürchtete, lange bemüht, den Parteitag hinauszuzögern.[113] Die Diskussion in Berlin war zunächst geprägt von der Kritik an der Rolle der USPD-Vertreter im Rat der Volksbeauftragten. Eine Dortmunder Delegierte bezeichnete es als unverzeihlichen Fehler, im vergangenen November in eine Regierung mit Ebert und Scheidemann – „Leute, die bis zum letzten Tage gegen die Revolution waren“[114] – eingetreten zu sein. Haase und andere Sprecher der Parteiführung verzichteten angesichts der einhelligen, aber noch kaum grundsätzlich begründeten Ablehnung ihres politischen Ansatzes darauf, die von ihnen zu verantwortende bisherige Parteilinie offensiv zu rechtfertigen. Hierbei kam ihnen zustatten, dass mit Ledebour (der hinter Gittern seinem Prozess entgegensah) der prominenteste Verfechter eines alternativen Kurses nicht am Parteitag teilnehmen konnte und viele Delegierte aus den mitgliederstarken und besonders aktiven Parteibezirken wegen der Streiks gar nicht oder nicht mehr rechtzeitig erschienen.[115] Haase betonte, dass nichts verloren und die Revolution nicht zu Ende sei, man befinde sich „mitten in einer Weltrevolution“,[116] ein neuer revolutionärer Aufschwung stehe zweifellos auch in Deutschland bevor. Eine Wiedervereinigung mit der SPD schloss er jetzt ausdrücklich aus. Der Parteitag entschied in diesem Sinne, Doppelmitgliedschaften fortan nicht mehr zu dulden. Eduard Bernstein, der im Dezember 1918 wieder in die SPD eingetreten war, trat daraufhin aus der USPD aus und hielt der Partei in einem offenen Brief eine „Politik der Negation und Zersetzung“[117] vor. Die von ihm gegründete Zentralstelle für die Einigung der Sozialdemokratie entfaltete im Sommer 1919 einige Aktivität, blieb aber in der USPD fast ganz ohne Resonanz.[118] Großes Aufsehen erregte der Parteiaustritt Clara Zetkins, die auf Anraten von Rosa Luxemburg und Leo Jogiches zunächst in der USPD verblieben war und nun den Parteitag nutzte, um ihren Übertritt zur KPD zu erklären. Dabei nahm sie die Position Kautskys in der Sozialisierungsfrage – seit Januar 1919 hatte dieser wiederholt erklärt, dass er „die Frage der Produktionsweise [für weniger dringlich halte als] […] die der Produktion selbst“[119] – zum Anlass. Bei der Debatte über das Rätesystem blieb eine grundsätzliche Klärung weiter aus. Der Parteiführung gelang es, in der vom Parteitag beschlossenen Programmatischen Kundgebung die Formulierung unterzubringen, dass die USPD die „Einordnung des Rätesystems in die [von der Nationalversammlung zu beschließende] Verfassung“ anstrebe.[120] Ernst Däumig, der seine Überlegungen zu einer reinen Räteverfassung ausführlich dargelegt hatte, stimmte diesem Dokument nicht zu. Für heftige Auseinandersetzungen sorgte auch seine Kritik am Auftreten der USPD-Delegation bei der internationalen sozialistischen Konferenz in Bern (3.–10. Februar 1919). Däumig nannte es „einfach unerhört“, dass die Parteiführung Männer nach Bern geschickt habe, „deren feindliche Einstellung gegen den Bolschewismus in der ganzen Internationale bekannt ist, Kautsky und Bernstein, die jede Gelegenheit wahrnehmen, um den Bolschewismus in Grund und Boden zu verdammen, und das in einer Zeit, in der wir hier in Deutschland im Zeichen der wüstesten Bolschewistenhetze stehen.“[121] Haase, dessen persönliches Ansehen noch unerschüttert war und der diese öffentliche Infragestellung der „Einheit der Partei“ streng verurteilte, weigerte sich anschließend, mit Däumig, der zunächst neben ihm zum Parteivorsitzenden gewählt worden war, zusammenzuarbeiten. Daraufhin wählte die linke Mehrheit des Parteitags den zu diesem Zeitpunkt als Anhänger Däumigs geltenden, aber wenig bekannten Stuttgarter Delegierten Arthur Crispien in dieses Amt. Wilhelm Dittmann notierte dazu:
- „Die ihn von früher als Radikalen kannten und ihn jetzt auf den Schild hoben, sahen – soweit sie überhaupt davon wussten – in ihrer Verlegenheitssituation geflissentlich über den 'Schönheitsfehler' hinweg, dass Crispien in der württembergischen Landesregierung nicht nur mit Rechtssozialisten, sondern sogar mit Bürgerlichen zusammengesessen hatte. Die ihn nicht näher kannten, vertrauten der ihnen gegebenen Versicherung, dass er radikal sei. Er hatte bisher bei keiner Richtung angeeckt und war daher auch nicht umstritten.“[122]
Nach dem Berliner Parteitag nahm die organisatorische Aufwärtsentwicklung der USPD, die sich bereits im Februar abgezeichnet hatte, weiter Tempo auf. Die Partei dehnte sich nun in der Fläche aus, ihre Presse wuchs quantitativ und qualitativ. Anfang März wies der Zentralrat die SPD-Führung warnend auf diese Entwicklung hin; es liege „etwas in der Luft“, die „Arbeiter laufen einfach zur USP über.“[123]
Nach Bekanntwerden der Friedensbedingungen am 7. Mai 1919 trat die USPD sofort und geschlossen für die Unterzeichnung des Friedensvertrages ein.[124] Sie leugnete nicht die Härte der Bestimmungen, bemühte sich aber gleichzeitig, gegen die nun losbrechenden nationalistischen Kampagnen anzukämpfen. Den anderen Parteien, die noch im Vorjahr den Friedensvertrag von Brest-Litowsk ratifiziert hatten, warf sie Heuchelei vor. Die Freiheit riet Ebert und Scheidemann, auf die rechte Gefahr zu achten und angesichts dieser ständig wachsenden Bedrohung damit aufzuhören, sich als „Athleten des Nationalismus“[125] zu gebärden. Bemerkenswert ist, dass es der Partei gelang, Massen für die Unterzeichnung des Vertrages auf die Beine zu bringen. Am 13. Mai fanden allein im Raum Berlin 40 einschlägige Großversammlungen der USPD statt.[126] Bei den parallelen Debatten über den Verfassungsentwurf trat die USPD-Fraktion in der Nationalversammlung mit den Positionen und Argumenten auf, die sie schon im Februar gegen die „vorläufige Reichsgewalt“ ins Feld geführt hatte. Ergänzend verfocht sie die Aufhebung der Einzelstaaten und trat insgesamt dafür ein, die Grundrechtsgarantien und demokratischen Beteiligungsrechte auf ein Maximum zu steigern. Die Sprecher der USPD bemühten sich außerdem mehrfach, den in Gestalt des Artikels 48 in die Verfassung eingebauten diktatorialen „Notausgang“ zu thematisieren. Am 5. Juli beantragte Oskar Cohn – vergeblich – die Streichung dieses Artikels.[127] Wilhelm Koenen bezeichnete die in Artikel 165 der Verfassung vorgenommene Adaption des Rätegedankens – Legalisierung von (zur Zusammenarbeit mit den Unternehmern verpflichteten) Betriebsräten und Schaffung eines Reichswirtschaftsrates – in der Schlussdebatte als „plumpen Betrug“.[128] Bei der Abstimmung über die Verfassung am 31. Juli 1919 votierte schließlich kein Abgeordneter der USPD für den Entwurf. 17 Fraktionsmitglieder stimmten mit Nein, fünf blieben der Abstimmung fern. Die Freiheit charakterisierte die neue Reichsverfassung am 5. August 1919 als „Verewigung der Schande der rechtssozialistischen Partei“.[129]
Der Einflussgewinn des linken Parteiflügels und die Spaltung der USPD 1920
Der Leipziger Parteitag und die Frage der Internationale

Trotz der erheblichen Dissonanzen während des Berliner Parteitages (2.–6. März 1919), auf dem Hugo Haase sich schließlich geweigert hatte, mit Ernst Däumig als gleichberechtigtem Vorsitzenden zusammenzuarbeiten, und dieser daraufhin, obwohl gewählt, auf das Amt verzichtete, schien in der USPD noch im Sommer 1919 keine deutliche Ausprägung von grundsätzlich widerstreitenden Flügeln stattgefunden zu haben. Die Gliederungen der Partei und die Parteipresse hatten die Weimarer Reichsverfassung einmütig abgelehnt, die solidarische Haltung gegenüber Sowjetrussland und der ungarischen Räterepublik wurde wiederholt bekräftigt. Die „dynamischste Arbeiterpartei dieser Periode“[130] wuchs rasant und konnte die Zahl ihrer Mitglieder zwischen Frühjahr und Herbst 1919 mehr als verdoppeln. Dass sich innerhalb der USPD unterdessen zwei unvereinbare Strömungen – eine linke, die eine im Grunde kommunistische Parteikonzeption vertrat, und eine rechte, die sich ideologisch mehr und mehr auf die SPD zubewegte – herausgebildet hatten, wurde beinahe unvermittelt deutlich, als auf der Berliner Reichskonferenz (9.–10. September 1919) das weitere Vorgehen in der Frage der Internationale zur Sprache kam.
Vertreter der USPD hatten sich, wenn auch in der Regel mit einiger Distanz, bis dahin an den nach Kriegsende einsetzenden Versuchen beteiligt, die 1914 zusammengebrochene II. Internationale zu reanimieren (Konferenzen in Bern, Amsterdam und Luzern). Das war von Anfang an aus der Partei heraus kritisiert, aber noch nicht als Frage von wegweisender Bedeutung thematisiert worden. Im Vorfeld der Luzerner Konferenz waren die grundsätzlich ablehnenden Stimmen allerdings schon so zahlreich, dass sich die Parteiführung Ende Juli gezwungen sah, mit Wilhelm Koenen und Walter Stoecker zwei Wortführer der Opposition in das Zentralkomitee zu kooptieren und anzukündigen, dass sie die neu entstehende Internationale zwingen wolle, „sich für uns oder für die Rechtssozialisten zu entscheiden.“[131] Auf der Berliner Tagung sprach sich Rudolf Hilferding zwar für diesen Vorbehalt, letztlich aber auch offen für den Anschluss an eine erneuerte II. Internationale, Stoecker dagegen für eine Orientierung auf die Kommunistische Internationale und den unumkehrbaren Bruch mit den deutschen und westeuropäischen „Nationalsozialisten“[132] aus. Im Spätsommer und Herbst wurde diese Frage mit wachsender Intensität von den Parteimitgliedern diskutiert, wobei sich schnell abzeichnete, dass die weit überwiegende Mehrheit Stoeckers Position favorisierte. Begünstigt wurde diese Tendenz durch den Umstand, dass die offizielle deutsche Sektion der Komintern, die KPD, im Oktober 1919 die Abtrennung ihres ultralinken Flügels, der auf dem Gründungsparteitag noch die Nichtteilnahme an Parlamentswahlen durchgesetzt hatte und gegen eine Mitarbeit in den ADGB-Gewerkschaften agitierte, einleitete (vgl. Heidelberger Parteitag). Diese im Februar 1920 mit dem Ausschluss mehrerer Parteibezirke abgeschlossene Spaltung kostete die KPD vermutlich die Hälfte ihrer im Herbst 1919 etwa 100.000 Mitglieder (darunter beinahe die gesamte Berliner Parteiorganisation), bereitete durch den Wegfall der offen sektiererischen Stimmen aber den Boden für eine Annäherung an die kooperationswilligen Lokalorganisationen der USPD.[133] Unter dem Eindruck der Stellungnahmen der Parteimitgliedschaft begann die USPD-Führung im Vorfeld des nach Leipzig einberufenen außerordentlichen Parteitages zu manövrieren und von ihrer bisherigen Linie abzurücken. Sie sprach sich nun für die Veranstaltung eines „sozialistischen Weltkongresses“ aus, zu dem alle auf dem Boden des Klassenkampfes und der Diktatur des Proletariats stehenden Parteien zugelassen werden sollten. So hoffte sie, eine Entscheidung zugunsten der „Moskauer Internationale“ und die dann unvermeidlichen programmatischen und politischen Festlegungen doch noch zu verhindern.[134]
Am 7. November 1919, wenige Wochen vor dem Parteitag, verstarb der USPD-Vorsitzende Hugo Haase an den Folgen eines Attentats. Er war am 8. Oktober vor dem Reichstagsgebäude – auf dem Weg ins Plenum der Nationalversammlung, wo er die Unterstützung deutscher Regierungsstellen für die Gegenrevolution im Baltikum thematisieren wollte – mit mehreren Schüssen niedergestreckt worden. Der Täter, ein österreichischer Arbeiter, wurde von der Justiz sofort als allein handelnder „beschränkter Monomane“ und „Idiot“ dargestellt; Ermittlungen zu möglicherweise vorhandenen Hintermännern unterblieben, der Anschlag wurde nie vollständig aufgeklärt.[135]
Der Auftakt des am 30. November 1919 im Leipziger Volkshaus eröffneten Parteitages ließ keinen Zweifel daran, dass die moderierende Taktik der Parteiführung nur bedingt aufgegangen war. Der Führungsgruppe der Linken um Däumig, Stoecker, Koenen und Otto Braß blieb nicht lange verborgen, dass „sie über eine sehr beträchtliche Mehrheit auf dem Parteitag verfügte.“[136] Zur Frage der Internationale lagen drei Anträge vor (Hilferding für die II. Internationale, Ledebour für den „Weltkongress“, Stoecker für die Komintern). Bei einer Unterschriftensammlung hatte mehr als die Hälfte der Delegierten den Antrag Stoecker unterstützt. Bis zur Behandlung dieser Anträge am 4. Dezember blieben größere direkte Zusammenstöße zwischen den Strömungen aus; ein Vorstoß rechter Delegierter um den Vorsitzenden der Schuhmachergewerkschaft Josef Simon, der Koenen, Stoecker und Curt Geyer am 2. Dezember wegen einer bekanntgewordenen Zusammenkunft mit Paul Levi der Kooperation mit einer „feindlichen Partei“ bezichtigte, verpuffte.[137] Das mehrstündige Referat Arthur Crispiens, der zur politischen Lage sprach, fand allgemeine Billigung; das ebenfalls von Crispien zur Abstimmung gestellte Aktionsprogramm, das sich für die „Zertrümmerung“ des bürgerlichen Staates und dessen Ablösung durch „politische Arbeiterräte als Herrschaftsorganisation des Proletariats“ aussprach, wurde einstimmig angenommen. Das Aktionsprogramm ging weit über die programmatischen Erklärungen vom März, in denen noch eine reichlich unklare „Einordnung“ der Räte in den bürgerlichen Staat propagiert worden war, hinaus. Es bildete so die seither gemachten Erfahrungen, vor allem aber den wachsenden Einfluss revolutionär-marxistischer Konzeptionen und die parallele Diskreditierung der Positionen Kautskys ab. Dass die USPD-Führung der Parteilinken in der Programmfrage unerwartet weit entgegenkam, stellte mit einiger Wahrscheinlichkeit erst sicher, dass die Partei nicht schon Ende 1919 auseinanderbrach.[138] Die Linke war sich indes der Problematik dieser Art von „Geschlossenheit“ bewusst:
- „Aber der linke Flügel […] wurde sich bald darüber klar, dass sein [Crispiens] Radikalismus sich auf ideologische Auseinandersetzungen beschränkte und sofort in die Brüche ging, wenn es sich um aktivistische revolutionäre Entscheidungen handelte. Er war für uns der typische Vertreter des Wortradikalismus und zugleich der Politik des Zauderns, der Versäumnisse und der Hilflosigkeit in Kampfsituationen, welche die Parteileitung der USPD im Jahr 1919 charakterisierte. Kein Wunder, dass wir seine Rede, als sie gedruckt vorlag, nach den Hintertüren durchspähten und auch einige fanden.“[139]
Der Auseinandersetzung um die Internationale verlieh das Aktionsprogramm allerdings zusätzliche Schärfe: Um selbiges verbindlich abzusichern, war der linke Flügel nun mehr denn je an einer Einbindung in die Komintern interessiert, während etwa die Gruppe um Hilferding aus genau gegenläufigen Gründen die „Autonomie“ der USPD betonte und vor den „Weisungen Moskaus“ warnte.[140] Hilferdings Rede am fünften Verhandlungstag wurde von den Delegierten kühl aufgenommen, seine Bemerkung, dass die – so meinte er – vor dem Untergang stehenden Bolschewiki die „Weltrevolution brauchen“, mit dem Zwischenruf „Brauchen wir das nicht?“ quittiert.[140] Da Hilferding sich auch dezidiert kritisch zu den Terrormaßnahmen der Bolschewiki geäußert hatte, stellte Stoecker seine Ausführungen ganz auf diesen Punkt ab. Anders als Hilferding und unter Rückgriff auf Äußerungen von Marx und Engels deutete er es nicht als Stärke, sondern als Schwäche vergangener Revolutionen, dass „sie sich an die Gesetze der Humanität und Menschlichkeit gebunden fühlten, während die Reaktion in unmenschlichster Weise“[141] agiert habe. Mit Verweis auf tausende Tote, die die deutsche Gegenrevolution seit dem November 1918 gefordert habe, betonte Stoecker, dass man offenbar „auch in Deutschland […] die proletarische Revolution nicht mit Glacéhandschuhen und Rosenwasser durchführen“[142] könne. Angesichts des Verzweiflungskampfes der Bolschewiki riet er dazu, sich „eines Urteils über den roten Terror“[141] zu enthalten. Seine Ausführungen fanden laut Protokoll „stürmischen, langanhaltenden Beifall, der sich auch auf die Galerien“[142] übertrug. Anschließend begründete Ledebour seinen Vorschlag einer internationalen, ergebnisoffenen Konferenz aller revolutionären Parteien. Da eine Mehrheit für Stoeckers Antrag bei dieser Ausgangslage sicher war, zogen Hilferding und Ledebour ihre Anträge in Abstimmung mit der Parteiführung zu Beginn des folgenden Verhandlungstages zurück. Anschließend brachte die Leitung einen neuen Antrag ein, der in geschickter Weise jede weitere Mitarbeit in der II. Internationale ausschloss, sich zum Rätesystem und zur Diktatur des Proletariats bekannte und den Beitritt zur Kommunistischen Internationale als Fernziel festschrieb. Zuvor sollte allerdings versucht werden, in Verhandlungen auch andere „sozialrevolutionäre Parteien“ Mittel- und Westeuropas für diesen Kurs zu gewinnen. Einerseits bedeutete diese Kompromisslösung aus Sicht der Parteilinken einen Schritt nach vorn – die Partei legte sich öffentlich und eindeutig auf die Kommunistische Internationale fest – andererseits aber konnte aufmerksamen Beobachtern nicht verborgen bleiben, dass die Parteiführung lediglich versuchte, Zeit zu gewinnen. Stoecker zog seinen Antrag deshalb nicht zurück, unterlag aber schließlich in namentlicher Abstimmung mit 111 gegen 170 Stimmen, da auch viele linke Delegierte nicht gewillt waren, den Flügelkampf wegen eines Streits um den bloßen Zeitpunkt des Beitritts zur Kommunistischen Internationale weiter zuzuspitzen. Die Kompromissresolution der Parteiführung wurde anschließend mit 227 gegen 54 Stimmen angenommen. Auch die Mehrzahl der zunächst noch für den Stoecker-Antrag stimmenden Delegierten votierte nach dem Scheitern im ersten Wahlgang für das Kompromisspapier, darunter der spätere KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann und Stoecker selbst. Ernst Däumig, der dem Kompromiss nicht zugestimmt hatte, wurde anschließend neben Crispien zum Parteivorsitzenden gewählt. Weitreichende Folgen für die weitere Entwicklung der USPD hatte es, dass die Parteilinke trotz ihres Übergewichts auf dem Parteitag im neu gewählten Vorstand erstaunlicherweise weiterhin stark unterrepräsentiert blieb – nur neun der 26 Leitungsmitglieder hatten Stoeckers Resolution unterstützt. Dennoch wurde der Leipziger Parteitag in der Öffentlichkeit als drastischer Linksruck der USPD wahrgenommen.[143]
Die USPD hatte den nach Kriegsende stark zunehmenden Antisemitismus aufmerksam registriert und befasste sich auf dem Leipziger Parteitag mit diesem Thema (Resolution Gegen Judenhetze).[144]
Die USPD und der Kapp-Putsch

Im Bunde mit der KPD versuchte der linke Flügel der USPD im Januar 1920 Massen notleidender Berliner Arbeiter für einen neuen Anlauf zur Errichtung einer Räteherrschaft zu mobilisieren. Das Ergebnis war am 13. Januar 1920 ein Blutbad am Reichstagsgebäude. Daraufhin verhängte die sozialdemokratische Reichsregierung den Ausnahmezustand und verbot die Zeitungen Freiheit und Die Rote Fahne. Am 19. Januar wurden zwölf Parteifunktionäre der USPD und der KPD, darunter die Vorsitzenden Ernst Däumig und Paul Levi, für einige Zeit inhaftiert.
Im Jahr 1920 gelang es, den Putschversuch des ostpreußischen Generallandschaftsdirektors Wolfgang Kapp und des Generals Walther von Lüttwitz abzuwehren, entscheidend hierfür waren ein neuerlicher Generalstreik der Gewerkschaften und die Gehorsamsverweigerung der Beamtenschaft. Bei der folgenden Reichstagswahl im Juni 1920 erreichte die USPD 17,9 % der Stimmen, während die SPD auf 21,3 % fiel.
Die „21 Bedingungen“ und der Parteitag in Halle
Unterdessen hatte die Debatte über die Frage der internationalen Anbindung, obschon durch die innerdeutschen Verwicklungen vorübergehend in den Hintergrund gedrängt, eine Entwicklung genommen, die schließlich zur Spaltung der Partei führte.
Mitte Dezember 1919 hatte sich die USPD-Führung mit einem Schreiben an das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale (EKKI) und 18 „befreundete“ Parteien gewandt, darunter die ILP und die BSP in Großbritannien, die französische SFIO, die österreichische SDAP, die US-amerikanische SPA, die norwegische Arbeiterpartei und die italienische PSI. In dem Brief erläuterte sie die Beschlüsse des Leipziger Parteitages und schlug vor, im Februar 1920 ein Vorbereitungstreffen für eine internationale, in Deutschland oder Österreich zu veranstaltende Konferenz abzuhalten. Schon dieses Schreiben stand in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem Beschluss des gerade beendeten Parteitages. Es sprach von einer erst noch zu schaffenden „wirkungsfähige[n] Internationale“[145] und lud die russische KPR(B) genauso wie die 17 anderen Parteien zu dem Februartreffen ein. Auf diese Weise nahm es unter der Hand die in Leipzig klar ausgesprochene Festlegung auf den Beitritt zur Komintern zurück und stellte indirekt sogar deren Existenz infrage. Die BSP wies in ihrem Antwortschreiben auf diese Problematik hin und lehnte den Vorschlag der USPD ab.[146] Andere angesprochene Parteien, deren Führungsgruppen meist ebenfalls unter dem Druck eines starken linken Flügels standen, zeigten sich aber interessiert.[147]
Die in Leipzig bestätigte zentristische Mehrheit des USPD-Vorstands nutzte vor allem die Zeit nach der Verhaftung Ernst Däumigs (19. Januar 1920), um die Leipziger Beschlüsse auch parteiöffentlich zu relativieren. Sie rief kurzfristig eine Reichskonferenz in Berlin (28. Januar) zusammen, auf der Crispien „in vollem Widerspruch zu seinem Auftreten in Leipzig“ zeigte, „wo er in der Frage der Internationale wirklich stand.“[148] Hier und bei einer Aussprache mit schweizerischen und französischen Sozialisten in Bern machte der Parteivorsitzende deutlich, dass für ihn ein Anschluss an die Komintern „ohne Bedingungen“[149] nicht in Betracht komme. In Reaktion darauf sprach sich seit Februar 1920 – verstärkt vor allem nach einer polnischen Offensive im Polnisch-Sowjetischen Krieg im April – eine ständig wachsende Zahl von Lokal- und Regionalorganisationen für den sofortigen und bedingungslosen Beitritt aus.[150] Damit hatte sich schon wenige Monate nach dem Leipziger Parteitag die Lagerbildung vom Herbst 1919 reproduziert.
Die nächste Runde der Auseinandersetzungen wurde durch das Schreiben eingeläutet, mit dem das EKKI auf den Brief der USPD vom Dezember 1919 reagierte. Das Dokument wurde der USPD-Führung erst mit zweimonatiger Verzögerung am 9. April 1920 von Michail Borodin übergeben. Vermutlich hatte das in Berlin tätige Westeuropäische Sekretariat der Komintern den Text wegen seines „unversöhnlichen Tons“[151] zurückgehalten. In Anlehnung an einen noch weitaus schärferen Entwurf aus der Feder Lenins kritisierte Grigori Sinowjew die Dezember-Initiative der USPD in dem umfangreichen Antwortschreiben als Versuch, die „Bewegung zurück in den Sumpf der gelben Zweiten Internationale zu ziehen.“[152] Er forderte in drastischen Worten die „Säuberung“ der USPD-Leitung und die Vereinigung der „besten Elemente“ der Partei mit der KPD.[151]
Das unerwartet feindselige Antwortschreiben des EKKI war vor allem deshalb von grundsätzlicher Bedeutung, weil aus ihm klar hervorging, dass die Komintern auf die Mitgliedschaft einer (vermeintlich) von „Kautskyanern“ geprägten USPD überhaupt keinen Wert legte. Damit war Crispiens und Hilferdings Taktik, die vorsah, im äußersten Fall die Mitgliedschaft unter „Bedingungen“ zu beantragen und durch die so provozierte Zurückweisung das EKKI vor der Parteiöffentlichkeit ins Unrecht zu setzen, von vornherein gegenstandslos. Der USPD-Vorstand vermied zunächst eine Antwort auf das Schreiben und hielt es vor der Partei geheim. Erst als die Rote Fahne und linke USPD-Blätter daraus zitierten, übergab er es am 20. Mai offiziell der Parteipresse und leitete so den offenen innerparteilichen Fraktionskampf ein, in dem sich der linke Flügel trotz der von der Führungsmehrheit ausgeübten Kontrolle über den zentralen Parteiapparat und den größten Teil der Parteipresse zunächst eindeutig in der Offensive befand. Ein deutliches Symptom dafür war, dass nun vermehrt die Forderung erhoben wurde, besonders exponierte Wortführer des äußersten rechten Flügels – vor allem Heinrich Ströbel, Siegfried Nestriepke und Karl Kautsky – aus der USPD auszuschließen. Während Nestriepke aus der Partei austrat und Ströbel Anfang Juli 1920 von seiner Parteiorganisation in Steglitz tatsächlich ausgeschlossen wurde, hielt sich Kautsky an einen brieflichen Rat Otto Bauers: Er solle sich vorerst nicht mehr öffentlich äußern, die USPD aber nicht verlassen und auf gar keinen Fall zur SPD wechseln, denn aus der USPD werde ihm niemand folgen, die „Rechtssozialisten“ aber seien „nicht nur durch ihre Kriegspolitik, sondern auch durch die Noske- und Heine-Politik (…) international so kompromittiert, dass Du jeden Anschluss an sie mit überaus starker Prestigeeinbuße bezahlen müsstest.“[153]
Im Juli 1920 reiste eine Delegation der USPD – Crispien, Dittmann, Stoecker und Däumig – zum II. Weltkongress der Kommunistischen Internationale (am 19. Juli in Petrograd eröffnet, dann vom 23. Juli bis zum 7. August in Moskau). Vom Parteivorstand hatte sie am 19. Juni das Mandat zu offiziellen Verhandlungen über einen Beitritt der USPD erhalten.[154] Der Kongress stand im Zeichen der Auseinandersetzung mit den von der Führung der KPR identifizierten rechten und linken „Abweichungen“ in der revolutionären Arbeiterbewegung. Während allerdings ultralinke Positionen bei den Beratungen tatsächlich nachdrücklich artikuliert wurden (aus Deutschland waren auch zwei Vertreter der KAPD angereist), meldete sich kein Diskussionsredner mit eindeutig „rechtsopportunistischen“ Positionen zu Wort. Aber vornehmlich gegen diese – und hier vor allem gegen die Führungsgruppen von USPD und SFIO – richteten sich die vom Kongress beschlossenen Leitsätze über die Bedingungen der Aufnahme in die Kommunistische Internationale (die „21 Bedingungen“),[155] durch die genau geregelt wurde, was man unter einer kommunistischen Partei zu verstehen habe und wie deren nur bedingt autonome Stellung in einer zentralistisch organisierten Internationale zu gestalten sei.
Bei Anlage und Durchführung der Debatte über die 21 Bedingungen, die das bisherige Politik- und Organisationsmodell der USPD so oder so radikal infrage stellten, begingen das EKKI, die Führung der russischen Partei und die in Moskau anwesenden Vertreter der KPD einen schweren Fehler, durch den ihre „Anhänger [in der USPD] in eine sehr verwundbare taktische Position“[156] manövriert wurden. In ihrer Fixierung auf den in der USPD zu diesem Zeitpunkt praktisch einflusslosen Kautsky griffen sie Crispien und Dittmann – die in Moskau für einen kollektiven Zusammenschluss der revolutionären Parteien Westeuropas mit der Komintern und eine entsprechende Entschärfung der „Leitsätze“ eintraten – im Plenum mehrfach als dessen „Vertreter“ an; Lenin etwa nannte Crispiens Beitrag eine „entschieden kautskyanische Rede“,[157] obwohl sich Crispien erneut zum Aktionsprogramm des Leipziger Parteitages – und damit zum Rätesystem und zur Diktatur des Proletariats – bekannt hatte, also zumindest öffentlich eindeutig Positionen vertrat, die Kautsky rundheraus ablehnte. Durch diesen Argumentationsstil wurde jene Strömung der USPD, die Crispiens Position – und zwar ohne dessen taktische Hintergedanken – teilte, in eine entschiedene Opposition zur Komintern gedrängt, die sich keineswegs von selbst verstand. Der rechte Flügel hatte nun die weidlich genutzte Möglichkeit, als Verteidiger der Leipziger Beschlüsse – und der Identität der Partei schlechthin – aufzutreten und die Debatte in eine Richtung zu lenken, bei der es nicht mehr um die Frage des Anschlusses an die Komintern, sondern lediglich um die Annahme oder Ablehnung der 21 Bedingungen zu gehen schien.[158] Curt Geyer sah in den 21 Aufnahmebedingungen deshalb das Dokument, das überhaupt erst „die Szene für den nun beginnenden wilden Parteikampf und den Spaltungsparteitag von Halle gesetzt“ habe, da die „echten“ Kautskyaner im Parteiapparat – vor allem Hilferding – sofort erkannt hätten, „welch ausgezeichnete Kampfmittel gegen die radikale Linke in der Partei diese Bedingungen darstellten.“[159] Kurzzeitig beschwor die ungeschickte Kongressregie sogar die Gefahr eines Bruchs mit den Protagonisten des linken Flügels der USPD herauf. Stoecker und Däumig, die die Aufnahmebedingungen politisch durchaus akzeptierten, warnten bei den Beratungen vor dem damit verbundenen hohen Risiko und wiesen insbesondere die von einigen Kongressrednern offen ausgesprochene Aufforderung zur Spaltung der Partei zurück: Die USPD entwickele sich unaufhaltsam nach links, kehre man aber, so Däumig, nur „mit einer Ausschlussliste“ aus Moskau zurück, werde dieses „gute Ergebnis“ ohne Not gefährdet; abgesehen davon wolle er, Däumig, keine „Internationale der Sekten und Gruppen“, sondern politisch um Mehrheiten in den vorhandenen Arbeiterorganisationen kämpfen.[160] Stoecker bezeichnete die „Absplitterung der KPD von unserer Partei“ 1918/19 – unmittelbar vor der Aufwärtsentwicklung des linken USPD-Flügels – ausdrücklich als „verhängnisvollen Fehler“; auch sei es verfehlt, „den Terrorismus offen als programmatische Taktik zu propagieren“, in Deutschland lägen zweifellos andere Voraussetzungen für die Diktatur des Proletariats vor als in Russland.[161] Wegen dieser Bemerkungen griffen Sinowjew und Radek die beiden USPD-Linken im Plenum nicht nur politisch, sondern auch in persönlich verletzender Weise an, woraufhin Däumig und Stoecker kurzzeitig mit dem Gedanken spielten, den Kongress zu verlassen. Trotz dieser Verwerfungen erklärte sich die USPD-Delegation, die ungeachtet heftiger interner Diskussionen nach außen bis zuletzt einigermaßen geschlossen auftrat, bei einem abschließenden Treffen mit EKKI-Vertretern zwei Tage nach dem Ende des Kongresses im Grundsatz mit dessen Resolutionen und Beschlüssen einverstanden. Lediglich Dittmann äußerte vorsichtige Zweifel an der restlosen Umsetzbarkeit der Aufnahmebedingungen.[162]
Nach der Rückkehr der Delegation brach der Fraktionskampf mit aller Heftigkeit neu auf. Crispien und Dittmann polemisierten – angetrieben von Hilferding – in der Parteipresse gegen die Aufnahmebedingungen, die sie nun als „unannehmbar“ geißelten (was sie in Moskau nicht getan hatten). Stoecker und Däumig sprachen sich umso entschiedener für deren wortgetreue Umsetzung aus. Der rechte Flügel, der seine grundsätzliche Gegnerschaft zur Kommunistischen Internationale durch die ostentative Zurückweisung der 21 Bedingungen nun wirksam maskieren konnte, rückte bei dieser Gelegenheit auch von der bisher positiven Besprechung der russischen Revolution ab; Dittmann etwa veröffentlichte einen vielbeachteten Artikel mit dem Titel Die Wahrheit über Sowjetrussland, in dem er ein düsteres Bild der dortigen Verhältnisse zeichnete. Auch deshalb waren die Auseinandersetzungen auf der zur Auswertung der Moskauer Beratungen einberufenen Berliner Reichskonferenz (1.–3. September) bereits „durch offene Feindschaft“[163] gekennzeichnet. Bei der Konferenz ging mit Georg Ledebour auch eine ehemalige Galionsfigur der Parteilinken offen zum rechten Flügel über.
Die Mehrheit des Zentralkomitees plante nun, den Sachverhalt rasch auf einem außerordentlichen Parteitag, den sie gegen den Widerstand der Linken möglichst zeitnah durchzuführen suchte, zu entscheiden. Eine längere Parteidebatte wollte sie vermeiden, da sie mit einer baldigen Abnutzung ihrer Argumente rechnen musste. Auf Kreis- und Bezirkskonferenzen zeichnete sich bereits ab, dass die Mehrheit der inzwischen beinahe 900.000 USPD-Mitglieder trotz der von den 21 Bedingungen ausgehenden „Schockwirkung“[164] nach wie vor hinter Stoecker, Däumig und Koenen stand. Bei der Vorbereitung des Parteitages schreckte die Parteiführung auch nicht vor dem Versuch einer manipulativen Modifizierung des Delegiertenschlüssels zurück, mittels der die Delegiertenzahl der Bezirke mit sicheren linken Mehrheiten auf ein Minimum reduziert werden sollte.[165] Außerdem dokumentierte sie ihre Entschlossenheit, im Zweifelsfall die Partei zu spalten. Bei der Konferenz der württembergischen Landesorganisation am 2.–3. Oktober zog die rechte Minderheit (44 von 214 Delegierten) mit Crispien an der Spitze demonstrativ aus dem Saal aus, nachdem die Mehrheit die Neuwahl des Landesvorstandes erzwungen hatte. Anschließend konstituierte sie sich mit der Begründung, dass die Delegiertenmehrheit zu den Kommunisten „übergelaufen“ sei, als „rechtmäßige“ Landesorganisation der USPD neu. Vergleichbares geschah im Parteibezirk Niederrhein. In Berlin weigerte sich die von der Hilferding-Gruppe kontrollierte Freiheit, die von der Bezirksorganisation beschlossene Neubesetzung der Redaktion vorzunehmen.[166] Auch der linke Flügel setzte in dieser Situation auf eine endgültige Klärung und wies die Vermittlungsversuche, die unter anderem von Kurt Löwenstein, Emil Höllein, Mathilde Wurm, Gerhard Obuch und Fritz Kunert ausgingen, zurück.
Der Parteitag von Halle, der am 12. Oktober 1920 im Volkspark eröffnet wurde, führte die Entscheidung herbei. Beide Seiten hatten prominente Gastredner gewonnen. Für die Anschlussbefürworter ergriff der EKKI-Vorsitzende Grigori Sinowjew mit einer mehrstündigen, in deutscher Sprache vorgetragenen Rede das Wort. Der rechte Flügel bot Jean Longuet und Julius Martow auf. Die Resolution der Parteilinken wurde von Stoecker und Däumig, die der Rechten – die sich nicht offen gegen die Komintern, sondern lediglich gegen die 21 Bedingungen aussprachen – von Ledebour eingebracht. Nur der Resolutionsantrag Stoecker/Däumig kam zur Abstimmung. Bei zwei Enthaltungen stimmten 236 Delegierte für und 156 gegen den auf der Grundlage der Beschlüsse des II. Weltkongresses zu vollziehenden Anschluss der USPD an die Kommunistische Internationale. Unter denen, die dagegen stimmten, waren Ledebour, Hilferding und Dittmann.[167] Als der Tagungsleiter die Resolution Ledebours zur Abstimmung aufrief, meldete sich Crispien zu Wort und erklärte, dass die Parteitagsmehrheit durch die vorangegangene Abstimmung de facto aus der USPD aus- und in die KPD eingetreten sei. Die Versammlung könne nicht mehr als Parteitag der USPD gelten. Daraufhin verließ die Minderheit geschlossen den Tagungsort und proklamierte andernorts ein Manifest, das „ironischerweise die entschiedensten der im Leipziger Programm niedergelegten Glaubenssätze der linken USPD enthielt.“[168] Die verbliebene linke Mehrheit, die in den folgenden Wochen als USPD (Linke) bzw. als USPD (Dritte Internationale) auftrat, wählte einen neuen Parteivorstand und wandte sich mit mehreren Resolutionen an die Partei und an die Öffentlichkeit. Den Vorsitz der Partei übernahmen Ernst Däumig und Adolph Hoffmann.
Die überwiegende Mehrheit der Parteifunktionäre, Redakteure und Mandatsträger – darunter 59 der 81 Reichstagsabgeordneten – schloss sich der Richtung Crispien/Hilferding/Ledebour an. Von den 60 Parteizeitungen gelangten nur 19 in die Hand der Linken. Dagegen stieß die Mehrheit der Mitglieder – im Höchstfall etwa 550.000 – zunächst zur USPD (Linke), die sich Anfang Dezember 1920 mit der KPD zur VKPD zusammenschloss. Zum Zeitpunkt der Vereinigung hatte die USPD (Linke) nach (sehr wahrscheinlich zu optimistischen)[169] eigenen Angaben noch mehr als 400.000 Mitglieder. Die KPD brachte rund 78.000 Mitglieder in die Fusion ein. Es gilt als gesichert, dass sich im Zuge der Parteispaltung zwar die Mehrheit der Altmitglieder von der USPD löste, in diesem Umfang aber nicht den Weg zur VKPD fand.[169] Im Januar 1921 hatte die VKPD nach Berechnungen Wheelers etwa 448.500 Mitglieder.[170] Dies war der höchste Mitgliederstand, den eine kommunistische Partei in Deutschland vor 1945 erreichte. Allerdings ging den links von der SPD agierenden Parteien durch die politischen und organisatorischen Verwerfungen der USPD-Spaltung innerhalb weniger Monate mindestens ein Drittel der bislang bei ihnen organisierten Mitglieder verloren.[171]
Die Rückkehr des rechten Parteiflügels zur SPD 1922

Zunächst lehnte eine Mehrheit der Rest-USPD jede Annäherung an die SPD ab. Die Minderheit der Delegierten des Hallenser Parteitages hatte sich nach ihrem Auszug in einem Manifest zwar vom „Putschismus links“, ebenso deutlich aber auch vom „Opportunismus rechts“ abgegrenzt.[172] Die nun von Arthur Crispien und Georg Ledebour geführte USPD bekannte sich theoretisch weiterhin zum Klassenkampf und zur Diktatur des Proletariats und lehnte Koalitionen mit bürgerlichen Parteien ausdrücklich ab; sie orientierte sich so anfänglich eher auf die KPD als auf die SPD. Das Konzept eines erneuerten zentripetalen „marxistischen Zentrums“ der deutschen Arbeiterbewegung, das insbesondere Ledebour, Kurt Rosenfeld und Robert Dißmann verfochten, schien auch organisationspolitisch nicht undurchführbar zu sein: Im April 1921 hatte die Partei noch immer rund 340.000 Mitglieder und gab etwa 50 Tageszeitungen heraus. Neben den traditionell starken Parteibezirken Berlin-Brandenburg (50.000 Mitglieder), Leipzig (52.900 Mitglieder) und Thüringen (36.000 Mitglieder) blieben auch Bezirke wie Pommern (10.100 Mitglieder), Ostpreußen (10.000 Mitglieder) und Bayern (19.600 Mitglieder) handlungsfähig.[173] Ausdruck des Beharrens auf Eigenständigkeit war auch die Beteiligung der USPD an der Gründung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien im Februar 1921 in Wien.
Schon im Frühjahr 1921 – insbesondere nach den Märzkämpfen in Mitteldeutschland – zeichnete sich aber deutlich ab, dass eine Mehrheit des Parteivorstands um Dittmann, Crispien, Hilferding und Breitscheid die Losung von der „Einigung des Proletariats“ weitgehend exklusiv auf USPD und SPD – wenn auch noch nicht im Sinne einer organisatorischen Verschmelzung – bezog. Bei der Ausarbeitung einer auf eine Annäherung an die SPD und gleichzeitige scharfe Abgrenzung von der KPD abzielenden Linie trat insbesondere Karl Kautsky, dessen Auffassungen seit 1919 „von der großen Mehrheit der Partei als völlig unvereinbar mit dem Wesen und Wollen der USPD“[174] zurückgewiesen worden waren und der sich in der Phase der Vorherrschaft des linken Parteiflügels aus der Parteiarbeit zurückgezogen und zwischen September 1920 und Januar 1921 auf Einladung der georgischen Menschewiki in Tiflis aufgehalten hatte, wieder hervor. Seine seit 1917 in mehreren Schriften ausgearbeitete antikommunistische bzw. antibolschewistische Plattform wurde nun erstmals breit rezipiert. Kautsky sprach jetzt auch ganz offen aus, dass er alle programmatischen Differenzen zwischen SPD und USPD mit Rücksicht auf „den gemeinsamen Gegensatz gegen den Kommunismus“[175] für nachrangig hielt. Zugleich vertrat er anfänglich mit Blick auf die unüberwindbar scheinende Abneigung der meisten USPD-Mitglieder gegen die „Noske-SPD“ die Ansicht, dass eine eventuelle Vereinigung der beiden Parteien in jedem Falle unter – so wie er sie verstand – „marxistischen“ Vorzeichen stattfinden würde. Die SPD nahm die Verunsicherung in der USPD aufmerksam zur Kenntnis und schlug ihr im Mai 1921 nach dem Rücktritt der Regierung Fehrenbach vor, gemeinsam mit dem Zentrum eine neue Regierung zu bilden. Zwar lehnte die USPD das ab, ihre Reichstagsfraktion sprach der Minderheitsregierung Wirth am 4. Juni aber das Vertrauen aus. Am 3. Juli 1921 diskutierte Scheidemann die Einigungsvorstellungen der SPD erstmals umfassend im Vorwärts.
Als ernstes Hindernis für eine Vertiefung der Einigungsdebatte erwies sich allerdings das Görlitzer Programm der SPD vom September 1921. Mit diesem Dokument hatte die SPD die Konsequenzen aus der seit 1914 verfolgten politischen Linie gezogen und war auch in ihren theoretischen Aussagen – gemessen am bis dahin formell noch immer gültigen Erfurter Programm – weit nach rechts gerückt. Dem zeitgenössischen Staat wurde nun jeder Klassencharakter abgesprochen, die alte „Staatsfeindlichkeit“ wurde für überholt erklärt und durch ein ausdrückliches Bekenntnis zum „demokratischen Volksstaat“ ersetzt. Das Programm, dessen sozialphilosophische Grundierung – auf Wunsch des Parteivorstands – der Neokantianer Karl Vorländer beigesteuert hatte, beschrieb den Sozialismus eher als immaterielles ethisches denn als ökonomisches Konzept. Im ersten, auch innerhalb der SPD mehrheitlich abgelehnten Programmentwurf fehlte sogar jeder Hinweis auf Klassen und Klassenkampf. Selbst Rudolf Hilferding, 1921/1922 einer der Wortführer des SPD-freundlichen Flügels der USPD, hielt eine Fortsetzung der Einigungsdiskussion unter diesen Umständen zunächst für sinnlos:
- „Aus dem reißenden Wolf ist ein umgängliches Haustier geworden. Die Umsturzpartei hat sich zu einem Verein für soziale Reform entwickelt, bei dem, abgesehen von dem Bekenntnis zur Republik, höchstens noch die Phraseologie an die Vergangenheit erinnert. Mit solchen Leuten kann die bürgerliche Gesellschaft auskommen, [sie] […] sind nach Theorie und Praxis für die Bourgeoisie bündnisfähig geworden.“[176]
Unter der Überschrift Die Kapitulation von Görlitz kommentierte auch die Leipziger Volkszeitung:
- „Von ihm [dem Görlitzer Parteitag] erwartete man einen großen Schritt zur Einigung der deutschen Arbeiterschaft. Der Schritt ist nach der entgegengesetzten Richtung getan worden. Der Beschluss zur Regierungsbildung und das neue Programm sind Hindernisse, die nicht nur der organisatorischen Einigung der beiden sozialdemokratischen Parteien (…), sondern auch ihrem praktischen Zusammenarbeiten, der vielberufenen Arbeitsgemeinschaft, erneut in den Weg gewälzt wurden. In dem Moment, wo man von den Rechtssozialisten einen Sammelruf an das Proletariat erwartete, kapitulierten sie vor der Partei der Schwerindustrie.“[177]
Einmal mehr war es Kautsky, der die abgebrochene Diskussion wieder aufnahm. Er bemühte sich, die Festlegungen des Görlitzer Programms zu relativieren und betonte, dass selbiges „dem Bekenntnis des Leipziger Aktionsprogramms der Unabhängigen Sozialdemokratie von 1919 zum Rätesystem entschieden vorzuziehen“[178] sei. Auf für ihn typische Weise versuchte er ergänzend, die von einer Mehrheit der USPD als Hauptproblem empfundene Koalitionspolitik der SPD „marxistisch“ zu rechtfertigen und ging dabei so weit, eine bekannte Wendung aus Marx’ Kritik des Gothaer Programms „zweckmäßig“ umzuformulieren:[179]
- „Zwischen der Zeit des rein bürgerlichen und des rein proletarisch regierten Staates liegt eine Periode der Umwandlung des einen in den anderen. Dem entspricht eine politische Übergangsperiode, deren Regierung in der Regel die Form einer Koalitionsregierung bilden wird.“[180]
Im Sinne Kautskys begannen Ende 1921 auch das USPD-Zentralorgan Freiheit und die einflussreiche Leipziger Volkszeitung, das „Zusammengehen der rechts von den Kommunisten stehenden Arbeitermassen“[181] zu propagieren. Auf dem Leipziger Parteitag (8.–12. Januar 1922) war bereits unübersehbar, dass Ledebour, der noch immer für eine Aktionsgemeinschaft aller drei großen Arbeiterparteien warb, mit dieser Position – zumindest unter den führenden Funktionären der USPD – inzwischen beinahe allein stand. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass Kautsky einige Wochen später den Bogen überspannte, als er mehrfach mit scharfen Worten gegen den Parteivorstand auftrat, nachdem dieser der von der KPD abgespaltenen Kommunistischen Arbeitsgemeinschaft den Weg in die USPD geebnet hatte. Er handelte sich damit schroff ablehnende Kommentare der meisten führenden Parteimitglieder ein, die jetzt deutlich erkannten, dass Kautskys „marxistische“ Argumentation auf eine einfache Wiedereingliederung der USPD in die SPD hinauslief. Dies aber lehnte nicht zuletzt auch der Kreis um die Leipziger Volkszeitung ab. Kautsky sah sich erneut isoliert und veröffentlichte im Mai 1922 eine Erklärung, in der er mit der USPD brach.[182]
Trotzdem war auch der Mehrheit der Parteiführung bewusst, dass die Zeit, in der ein halbwegs erfolgreiches Lavieren zwischen KPD und SPD möglich war, zu Ende ging. Zum Zeitpunkt von Kautskys Abgang hatte der politische und organisatorische Zerfall der USPD bereits begonnen. Die Partei litt seit Anfang 1922 besonders stark unter der galoppierenden Inflation, da sie, anders als die SPD, kaum über Sachwerte verfügte. Im Sommer 1922 manövrierte die USPD am Rande des Bankrotts, kurzzeitig stand ernsthaft in Frage, ob sie überhaupt noch Wahlkämpfe würde finanzieren können.[183] Im Zuge der Auseinandersetzungen um die Positionen Kautskys zwang die Parteiführung auf Initiative Ledebours im April die von Hilferding geleitete Redaktion der Freiheit zum Rückzug.[184] Umgekehrt drängte in der Reichstagsfraktion eine schnell wachsende Gruppe von Abgeordneten, die bei Neuwahlen den Verlust ihrer Mandate befürchtete, auf eine Vereinigung mit der SPD und brach bei Abstimmungen wiederholt die Fraktionsdisziplin. Die letzten politischen Aktiva der USPD waren – abgesehen von der durch den Beitritt der KAG-Abgeordneten auf 72 Köpfe angewachsenen Reichstagsfraktion – die Koalitionsregierungen, die sie in Braunschweig, Sachsen und Thüringen mit den dortigen „linken“ Landesorganisationen der SPD gebildet hatte. In dieser Krisensituation fiel am 24. Juni 1922 Reichsaußenminister Rathenau einem Mordanschlag von Rechtsradikalen zum Opfer. Nach diesem Attentat – dem Anschläge auf Karl Gareis, Erzberger und Scheidemann vorausgegangen waren – und angesichts der parallelen, von einer Mehrheit des bürgerlichen Lagers getragenen Kampagne gegen die „Erfüllungspolitik“ der Regierung Wirth, die einen unübersehbar antirepublikanischen und monarchistischen Einschlag hatte, stellte sich eine Mehrheit der USPD-Führung auf den Standpunkt, dass sich das politische Klima deutlich zu Ungunsten der Linken verändert habe und daher eine rasche Einigung der gespaltenen Sozialdemokratie dringend geboten sei. Zustimmung fand das Urteil Wilhelm Dittmanns, der von einer „Situation wie vor dem Kapp-Putsch“[185] sprach. Der Rathenau-Mord trug so entscheidend zur überraschend schnellen Vereinigung der beiden sozialdemokratischen Parteien bei.[186]
Am 14. Juli 1922 bildeten die Fraktionen von SPD und USPD im Reichstag eine Arbeitsgemeinschaft. Damit wurde die USPD faktisch Regierungspartei; unter anderem brachte sie am 18. Juli das Republikschutzgesetz mit durch den Reichstag. Ende August traten die Vorstände beider Parteien zusammen und vereinbarten, auf getrennten Sonderparteitagen über die Vereinigung abstimmen zu lassen und dieselbe dann auf einem gemeinsamen Parteitag zu realisieren. Die SPD-Führung wusste um die breite, von der Rathenau-Krise nur vorübergehend verdeckte Skepsis unter Mitgliedern und Anhängern der USPD und gestand klugerweise zu, dass die Vereinigung formal als Fusion zweier gleichberechtigter Parteien abgewickelt wurde. Als programmatische Grundlage der so avisierten „neuen“ Partei einigten sich die Parteivorstände auf ein am 6. September von Freiheit und Vorwärts veröffentlichtes Aktionsprogramm, wodurch nebenbei das für die USPD nach wie vor indiskutable Görlitzer Programm stillschweigend aus dem Verkehr gezogen wurde. Das Aktionsprogramm enthielt lediglich tagespolitische Forderungen und sparte langfristige Festlegungen sowie theoretische Erörterungen über Staat, Revolution, Sozialismus und Kapitalismus vollständig aus. Dadurch entstand bei USPD-Linken wie Robert Dißmann, der nach eigenem Bekunden nur „mit starker Überwindung den Vereinigungsprozess“[187] mitmachte, der Eindruck, dass die zukünftige politische Ausrichtung der Sozialdemokratie in gewisser Weise offen und gestaltbar sei. Trotz der geschickten Vorbereitung kam es auf dem Sonderparteitag der USPD in Gera (20.–23. September 1922[188]) vorübergehend zu einer ernsten Krise, da unerwartet 122 von 192 Delegierten einen von Dißmann, Toni Sender und Fritz Zubeil initiierten Antrag unterstützten, in dem die bisherige Koalitionspolitik der SPD scharf missbilligt und verlangt wurde, die neue Partei in der Koalitionsfrage auf die Beschlüsse des Leipziger Parteitages der USPD festzulegen. Daraus ergab sich eine „eigenartige Situation“:[37] Offenkundig lehnte eine Mehrheit der Delegierten die Vereinigung zu diesem Zeitpunkt und unter diesen Bedingungen ab, war aber gleichzeitig nicht in der Lage, Gründe für die Fortexistenz der USPD anzuführen, die politisch tragfähiger waren als der Dissens in der Koalitionsfrage und die tiefsitzende menschliche Abneigung gegen die „Noskiten“ und „Ebertiner“. Dies ausnutzend konnte der Kreis um Crispien und Hilferding durchsetzen, dass über den für die SPD unannehmbaren Antrag Dißmann nicht abgestimmt und derselbe lediglich im Protokoll vermerkt wurde.[189] Nur eine kleine, von Ledebour geführte Minorität der linken Delegierten lehnte eine Vereinigung beharrlich als „Selbstmord der USPD“[190] ab. Der entscheidende, von Crispien eingebrachte Antrag wurde schließlich – obschon sich Fritz Zubeil im Namen des linken Flügels „entsetzt über die Einheitsrede“[187] Crispiens zeigte – mit überwältigender Mehrheit (gegen 9 Stimmen) angenommen. Ledebour hatte zuvor unfreiwillig zum Auseinanderbrechen des linken Flügels beigetragen, weil er in seiner Rede alle Delegierten, die seinen jede Einigungsverhandlung ablehnenden Antrag nicht unterstützt hatten, als Gesinnungsgenossen des bayerischen Sozialdemokraten Erhard Auer – in der USPD neben Noske „der Inbegriff des Verrats“[191] – bezeichnete (der anders als Noske heute weitgehend vergessene Auer war neben Wolfgang Heine und dem später zunächst ins völkisch nationalistische, schließlich ins konservative Lager abgewanderten August Winnig einer der Sozialdemokraten, die ihre Rolle bei der Niederschlagung der Rätebewegung öffentlich zelebrierten – unter anderem hatte Auer dem Eisner-Mörder Graf Arco nach der Tat einen üppigen Blumenstrauß überbringen lassen).[192]
Am 24. September 1922 traten 146 Delegierte der SPD und 135 der USPD in Nürnberg zum Vereinigungsparteitag zusammen. Um keine Misstöne aufkommen zu lassen, erklärte Otto Wels als Versammlungsleiter gleich eingangs jede Diskussion für „überflüssig“. Die Tagung dauerte nur knappe drei Stunden und war schon zur Mittagsstunde wieder beendet. Zuvor hatten die Delegierten unter anderem das Aktionsprogramm einstimmig bestätigt, drei Vorsitzende (Hermann Müller, Otto Wels, Arthur Crispien) sowie eine Kontroll- und eine Programmkommission (unter der Leitung Kautskys) gewählt. Damit galt die Verschmelzung zur Vereinigten Sozialdemokratischen Partei Deutschlands als erfolgt. In den Gremien der Partei gaben die Vertreter der alten SPD von Anfang an den Ton an. Die USPD stellte von drei Vorsitzenden einen (Arthur Crispien), von den sechs Parteisekretären ebenfalls nur einen (Wilhelm Dittmann), von drei Kassierern einen (Konrad Ludwig) und von den zehn Beisitzern vier (Franz Künstler, Rudolf Hilferding, Julius Moses, Anna Nemitz). Im Parteivorstand betrug das Verhältnis SPD:USPD somit 15:7. Immerhin etwa ein Drittel der 290.000 USPD-Mitglieder trat der VSPD nicht bei.[193] Nicht wenige schlossen sich offenbar der KPD an, deren Mitgliederzahl im Herbst 1922 auffällig anstieg.[194]
Die USPD als Splitterpartei 1923–1931
Eine Funktionärsgruppe um Georg Ledebour, Gustav Laukant, Paul Wegmann, Gerhard Obuch und Theodor Liebknecht lehnte jede Koalitionspolitik mit bürgerlichen Parteien und damit auch die Rückkehr zur SPD ab. Liebknecht – dessen Bruder Karl 1919 ermordet worden war – und Ledebour machten zudem mehrfach deutlich, dass es für sie auch persönlich unmöglich sei, jemals wieder mit Ebert, Scheidemann und Noske Mitglied in ein und derselben Partei zu sein.[195] Sie planten, die USPD zum Kristallisationskern einer neuen Einheitspartei der Arbeiterbewegung zu machen und führten sie deshalb fort. Als neues Zentralorgan erschien seit Oktober 1922 in Berlin das Wochenblatt Klassenkampf.
Über den 1922/1923 vorhandenen Einfluss und Organisationsumfang der Rest-USPD lassen sich kaum Angaben machen. Offenbar verfügte sie vielerorts zunächst noch über einen gewissen Anhang. Der eigentliche Zusammenbruch erfolgte erst im Frühjahr 1924, nachdem Ledebour aus der Partei ausgeschlossen worden war (11. Januar) und im März 1924 eine neue Organisation, den Sozialistischen Bund, gegründet hatte. Grund hierfür war der Dissens über die Linie in der Frage der Ruhrbesetzung: Ledebour unterstützte den Kurs der KPD, eine Mehrheit um Liebknecht lehnte deren Parole „Schlagt Poincaré an der Ruhr und Cuno an der Spree!“ aber als nationalistisch ab. Bei der Reichstagswahl im Mai 1924 erzielte die Partei noch 0,8 % der Stimmen, was normalerweise für eine Vertretung im Reichstag genügt hätte, da sie aber in keinem Reichswahlkreis und keinem Reichswahlkreisverband auf 60.000 Stimmen kam, blieb sie ohne Mandate, ebenso wie der abgesplitterte Sozialistische Bund; bei den folgenden Reichstagswahlen waren die Ergebnisse noch niedriger. Die Rest-USPD hielt 1924 in Eisenach, 1925 in Berlin und 1926 in Leipzig Parteitage ab. Zur weiteren Entwicklung der Partei liegen praktisch keine Quellen vor.[196] Bekannt ist, dass sie bei der Reichspräsidentenwahl 1925 zur Stimmenthaltung aufrief, während die Ledebour-Gruppe zur Wahl Ernst Thälmanns aufforderte. Am 1. November 1931 gab die USPD ihr Aufgehen in der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands bekannt. Bei den Verhandlungen im Vorfeld hatte sie keine einzige ihrer anfänglich formulierten Beitrittsbedingungen durchsetzen können.[197]
Remove ads

| Wahl | Stimmen (absolut) | Stimmen (relativ) | Mandate |
|---|---|---|---|
| Wahl zur Deutschen Nationalversammlung (1919) | 2.317.290 | 7,62 % | 22 |
| Reichstagswahl 1920 | 4.897.401 | 18,81 % | 84 |
| Reichstagswahl Mai 1924 | 235.145 | 0,80 % | 0 |
| Reichstagswahl Dezember 1924 | 98.842 | 0,33 % | 0 |
| Reichstagswahl 1928 | 20.815 | 0,07 % | 0 |
| Reichstagswahl 1930 | 11.690 | 0,03 % | 0 |
Die Wahlergebnisse von 1920 enthalten nicht die Wahlkreise 1 (Ostpreußen), 10 (Oppeln) und 14 (Schleswig-Holstein), da in diesen erst 1921 bzw. 1922 gewählt wurde. Unter Berücksichtigung der Nachwahlen bis 1922 lautet der entsprechende Prozentanteil 17,63 %.
Mitgliederzahlen
| Jahr | Mitgliederzahl |
|---|---|
| November 1918 | ca. 100.000 |
| Ende Januar 1919 | ca. 300.000 |
| September 1920 | 893.923 |
| April 1921 | 339.951 |
| September 1921 | 300.659 |
| Juni 1922 | 290.762 |
| 1925 | ca. 10.000 |
Presse
Zentrale Organe waren die Tageszeitung Freiheit und das wöchentlich unter der Redaktion von Rudolf Breitscheid erscheinende Theorieorgan Der Sozialist. Ebenfalls zentral erstellt wurde die illustrierte wöchentliche Beilage Die freie Welt. Daneben verfügte die USPD über eine Reihe regionaler Tageszeitungen, von denen einige wie die Leipziger Volkszeitung und das Volksblatt für Halle und den Saalkreis zur USPD übergewechselte SPD-Zeitungen waren, andere wie die Hamburger Volkszeitung Neugründungen. Die vom linken Flügel dominierten Parteiorgane (wie die beiden letztgenannten Zeitungen) gingen Ende 1920 an die VKPD, andere 1922 an die SPD, fusionierten mit sozialdemokratischen Blättern oder wurden eingestellt. Ab Oktober 1922 erschien als Zentralorgan die Wochenzeitung Klassenkampf, welche ab 1928 wieder unter dem Titel des alten Zentralorgans Freiheit erschien.
Jugend
Die USPD verfügte über keinen Parteijugendverband im eigentlichen Sinne. Zunächst standen Teile der Freien Sozialistischen Jugend (FSJ) der USPD nahe. Nachdem eine Mehrheit der FSJ sich an der KPD orientierte, konstituierte sich eine Minderheit 1919 unter dem Namen Sozialistische Proletarierjugend (SPJ) als eigenständiger, der USPD nahestehender, aber organisatorisch eigenständiger Verband. Die zu diesem Zeitpunkt 20.000 Mitglieder zählende SPJ schloss sich im Herbst 1922 mit dem sozialdemokratischen Verband der Arbeiterjugendvereine Deutschlands zur Sozialistischen Arbeiter-Jugend (SAJ) zusammen.
Remove ads
Die historische Bedeutung der USPD führte nach Ende des Zweiten Weltkriegs mehrfach dazu, dass linke Parteiabspaltungen aus der SPD diesen Namen aufgriffen. Allerdings erzielte keine dieser Splitterparteien einen vergleichbaren politischen Erfolg.
USPD Berlin
Um 1950 konstituierte sich aus von der SPD-Politik enttäuschten linken Sozialdemokraten in West-Berlin eine USPD, die bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 1950 9.782 Stimmen (0,7 %) und 1954 1.482 Stimmen (0,1 %) erhielt und sich einige Jahre später auflöste.
Die USPD in der DDR
Am 16. Februar 1990 formierte sich in Fürstenberg/Havel erneut eine USPD. Sie fühlte sich dem linken sozialdemokratischen Erbe verbunden und wollte für einen Demokratischen Sozialismus in der DDR kämpfen. Die Splitterpartei blieb bei der Volkskammerwahl 1990 mit 3.891 Stimmen (0,0 Prozent) erfolglos.
Neugründungen 2006/2007
Am 8. Februar 2006 wurde auf einem Gründungsparteitag in Gladbeck eine USPD von ehemaligen SPD-Mitgliedern und WASG-Enttäuschten ins Leben gerufen. Den Unabhängigen sozialen progressiven Demokraten, einer Gruppe ehemaliger SPD-Mitglieder und Gemeindevertreter in Rösrath, wurde im Frühjahr auf Grund von einstweiligen Verfügungen seitens des SPD-Bundesvorstandes die Benutzung der Kürzel USPD und UspD untersagt. Die Gruppe verwendete danach keine Abkürzung ihres Namens mehr. Mittlerweile ist sie der Partei Die Linke beigetreten.[198]
Remove ads
- Hartfrid Krause: Die USPD 1917 – 1931 – Spaltungen und Einheit, Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2021, ISBN 978-3-89691-051-6
- Bernward Anton: Die Spaltung der bayerischen Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg und die Entstehung der USPD. Vorgeschichte-Verlauf-Ursachen, Dissertation. Augsburg 2015, 1367 S. (Datensatz zur Veröffentlichung bei opus.bibliothek.uni-augsburg.de incl. unentgeltlichem Link zum pdf-download).
- Hans Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918–1923. Zur Geschichte und Soziologie der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (Syndikalisten), der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands und der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands (= Marburger Abhandlungen zur politischen Wissenschaft. Bd. 13, ISSN 0542-6480). Hain, Meisenheim am Glan 1969, (Zugleich: Marburg, Universität, Dissertation, 1968), (Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. Ein Beitrag zur Sozial- und Ideengeschichte der frühen Weimarer Republik Aktualisierte und mit einem Nachwort versehene Neuausgabe. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993, ISBN 3-534-12005-1).
- Andreas Braune, Mario Hesselbarth und Stefan Müller (Hrsg.): Die USPD zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus 1917–1922. Neue Wege zu Frieden, Demokratie und Sozialismus? (= Weimarer Schriften zur Republik Band 3). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-515-12142-2
- James Broh: Entwurf eines Programms der U. S. P. Verfasst im Auftrag der Politischen Kommission des Aktionsrats Charlottenburg sowie Kritik des Aktionsprogramms und des Revolutionsprogramms. Verlag Gesellschaft und Erziehung, Berlin-Fichtenau 1920.
- Dieter Engelmann: Die Nachfolgeorganisationen der USPD. In: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung. (BzG). Bd. 33, Nr. 1, 1991, ISSN 0942-3060, S. 37–45, (zur USPD und zum Sozialistischen Bund 1922–1931).
- Dieter Engelmann, Horst Naumann: Zwischen Spaltung und Vereinigung. Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands in den Jahren 1917–1922. Edition Neue Wege, Berlin 1993, ISBN 3-88348-212-9.
- Curt Geyer: Die revolutionäre Illusion. Zur Geschichte des linken Flügels der USPD. Erinnerungen (= Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Nr. 33). Herausgegeben von Wolfgang Benz und Hermann Graml. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1976, ISBN 3-421-01768-9.
- Alfred Hermann: Die Geschichte der pfälzischen USPD. Verlag Pfälzische Post, Neustadt an der Weinstraße 1989, ISBN 3-926912-12-X (Zugleich: Mannheim, Universität, Dissertation, 1989).
- Hartfrid Krause: USPD. Zur Geschichte der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main u. a. 1975, ISBN 3-434-20075-4.
- Ottokar Luban: Die Rolle der Spartakusgruppe bei der Entstehung und Entwicklung der USPD Januar 1916 bis März 1919. In: JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Bd. 2, 2008, S. 69–75.
- Ottokar Luban: Russische Bolschewiki und deutsche Linkssozialisten am Vorabend der deutschen Novemberrevolution. Beziehungen und Einflussnahmen. In: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung. 2009, S. 283–298.
- David W. Morgan: The Socialist Left and the German Revolution. A History of the German Independent Social Democratic Party, 1917–1922. Cornell University Press, Ithaca NY u. a. 1975, ISBN 0-8014-0851-2.
- Richard Müller: Eine Geschichte der Novemberrevolution. Neuauflage. Die Buchmacherei, Berlin 2011, ISBN 978-3-00-035400-7 (Nachdruck der drei Bände: Vom Kaiserreich zur Republik, Die Novemberrevolution, Der Bürgerkrieg in Deutschland, Malik-Verlag, Wien/Berlin 1924–1925).
- Eugen Prager: Geschichte der USPD. Entstehung und Entwicklung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Verlagsgenossenschaft „Freiheit“, Berlin 1921, Digitalisat, (Das Gebot der Stunde. Geschichte der USPD. Mit einem Vorwort von Ossip K. Flechtheim. 4., annotierte Auflage. Dietz, Berlin u. a. 1980, ISBN 3-8012-0049-3).
- Robert F. Wheeler: USPD und Internationale. Sozialistischer Internationalismus in der Zeit der Revolution (= Ullstein-Bücher. Nr. 3380, Ullstein-Materialien). Ullstein, Frankfurt am Main u. a. 1975, ISBN 3-548-03380-6.
Remove ads
Commons: Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Michael Jäger: 1917: Der kurze dritte Weg; Artikel in der Wochenzeitschrift der Freitag vom 8. April 2017 (Print-Ausgabe 14/2017) zur Entstehungsgeschichte der USPD mit Fokus auf deren ersten Parteivorsitzenden Hugo Haase und dessen Kontroverse mit Rosa Luxemburg als Protagonistin der Spartakusgruppe (online auf www.freitag.de, abgerufen am 8. April 2017)
- Karena Kalmbach: Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) In: LeMO des Deutschen Historischen Museums
- Mario Hesselbarth: Zur Geschichte der USPD. Aus Anlass des 100. Jahrestages ihrer Gründung 1917 in Gotha, Veröffentlichung für die Rosa-Luxemburg-Stiftung von April 2017 (PDF-Datei)
- Übersichtskarten zum Stimmenanteil der USPD bei den Reichstagswahlen während der Weimarer Republik nach Wahlkreisen
- Website von Ernst-Albert Seils mit Beiträgen zu Hugo Haase und seiner Zeit
Remove ads
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
Remove ads